
Das Eismeer
Kapitel Elf
„ Immer noch bei der Arbeit!“ rief Crayford aus, auf die halbzerstörte Bettstatt blickend. „Gönne dir ein wenig Ruhe, Richard. Das Erkundungskommando ist bereit zum Aufbrechen. Wenn du Abschied nehmen willst von deinen Offizierskameraden, bevor sie gehen, hast du keine Zeit zu verlieren.“
Hier unterbrach er sich, Wardour voll ins Gesicht schauend.
„ Lieber Himmel!“, rief er aus, „wie fahl du bist! Ist irgend etwas passiert?“
Frank – der in seiner Truhe nach Kleidungsstücken suchte, welche er auf der Reise möglicherweise benötigte – schaute sich um. Er erschrak, wie Crayford sich erschrocken hatte, ob der plötzlichen Veränderung in Wardour, seit sie ihn zum letzten Mal gesehen hatten.
„ Sind Sie krank?“ fragte er. „Ich höre, daß Sie Batesons Arbeit für ihn erledigt haben. Haben Sie sich verletzt?“
Wardour bewegte plötzlich den Kopf, so, als wolle er sein Gesicht verstecken vor beiden, Crayford und Frank. Er nahm sein Taschentuch heraus und wickelte es unbeholfen um seine linke hand.
„ Ja“, sagte er; „ich habe mich mit der Axt verletzt. Es ist nichts. Kümmern Sie sich nicht darum. Schmerz hat immer einen seltsamen Effekt auf mich. Ich sage Ihnen, es ist nichts! Beachten Sie es nicht!“
Er wandte ihnen sein Gesicht so plötzlich wieder zu, wie er es weggedreht hatte. Er ging einige Schritte vorwärts, und trat mit einer beunruhigenden Vertrautheit an Frank heran.
„ Ich habe Ihnen nicht höflich geantwortet, als Sie mich vor Kurzem ansprachen. Ich meine, als ich das erste Mal hereinkam mit den restlichen Männern. Ich entschuldige mich. Geben wir einander die Hände! Wie geht es Ihnen? Bereit für den Marsch?“
Frank begegnete dem sonderbar abrupten Annäherungsversuch an ihn mit gänzlich guter Laune.
„ Ich bin froh, mit Ihnen befreundet zu sein, Mr. Wardour. Ich wünschte, ich wäre ebensogut an die Strapazen gewöhnt, wie Sie es sind.“
Wardour brach in ein hartes, freudloses, unnatürliches Lachen aus.
„ Nicht robust, eh? So sehen Sie auch nicht aus. Die Würfel hätten besser mich fortgeschickt und Sie hierbehalten. Ich habe mich nie in meinem Leben in besserer Form gefühlt.“ Er machte eine Pause und fügte hinzu, mit seinem Blick auf Frank und mit einer starken Betonung in den Worten: „Wir Männer aus Kent sind aus einem harten Material gemacht.“
Frank ging seinerseits einen Schritt vor, mit einem neuen Interesse an Richard Wardour.
„ Sie kommen aus Kent?“ sagte er.
„ Ja. Aus dem Osten Kents.“ Er wartete noch ein wenig, und schaute Frank fest an. „Kennen Sie diesen Teil des Landes?“ fragte er.
„ Ich sollte etwas über den Osten Kents wissen“, antwortete Frank. „Einige liebe Freunde von mir haben einst dort gelebt.“
„ Freunde von Ihnen?“ wiederholte Wardour. „Eine der Landfamilien, vermute ich?“
Während er die Frage stellte, schaute er sich abrupt über die Schulter. Er stand zwischen Crayford und Frank. Crayford, der nicht an der Unterhaltung teilnahm, hatte ihn beobachtet und ihm immer aufmerksamer zugehört, während die Unterhaltung weiterging. Innerhalb der letzten paar Minuten war Wardour dies instinktiv bewußt geworden. Er ärgerte sich über Crayfords Verhalten, mit unnötiger Gereiztheit.
„ Warum starrst du mich an?“ fragte er.
„ Warum siehst du nicht wie du selbst aus?“ antwortete Crayford leise.
Wardour gab keine Erwiderung. Er nahm die Unterhaltung mit Frank wieder auf.
„ Eine der Landfamilien?“ fuhr er fort. „Die Winterbys aus Yew Grange, könnte ich mir denken?“
„ Nein“, sagte Frank; „aber sehr wahrscheinlich Freunde der Winterbys. Die Burnhams.“
So verzweifelt Wardour auch darum kämpfte, sie aufrecht zu erhalten, seine Selbstkontrolle ließ ihn im Stich. Er sprang ungestüm auf. Das ungeschickt herumgewickelte Taschentuch fiel ihm aus der Hand. Ihn noch immer aufmerksam beobachtend, hob Crayford es auf.
„ Da ist dein Taschentuch, Richard“, sagte er. „Seltsam!“
„ Was ist seltsam?“
„ Du hast uns erzählt, daß du dich mit der Axt verletzt hast–“
„ Und?“
„ Es ist kein Blut auf deinem Taschentuch.“
Wardour schnappte Crayford das Taschentuch aus der Hand, und näherte sich, während er sich wegdrehte, der äußeren Tür der Hütte. „Kein Blut auf dem Taschentuch“, sagte er zu sich selbst. „Es könnten einige Flecken darauf sein, wenn Crayford es wiedersieht.“ Er hielt einige Schritte vor der Tür an und sprach Crayford an. „Du hast mir vorgeschlagen, mich von meinen Offizierskameraden zu verabschieden, bevor es zu spät sei“, sagte er. „Ich werde gehen, um deinem Rat zu folgen.“
Gerade als er seine Hand auf das Schloß legte, wurde die Tür von draußen geöffnet. Einer der Quartiermeister der Wanderer betrat die Hütte.
„ Ist Captain Helding hier, Sir?“ fragte er, sich an Wardour wendend.
Wardour zeigte auf Crayford.
„ Der Lieutenant wird es Ihnen sagen“, erwiderte er.
Crayford trat vor und befragte den Quartiermeister. „Was möchten Sie von Captain Helding?“ wollte er wissen.
„ Ich habe einen Bericht zu machen, Sir. Es hat einen Unfall auf dem Eis gegeben.“
„ Einer Ihrer Matrosen?“
„ Nein, Sir. Einer unserer Offiziere.“
Wardour, der soeben im Begriff war, hinauszugehen, hielt inne, als der Quartiermeister diese Antwort gab. Einen Moment lang überlegte er. Dann ging er langsam zurück zu dem Teil des Raums, in welchem Frank stand. Crayford, der dem Quartiermeister den Weg zeigte, wies zu dem bogenförmigen Zugang an der Seite der Hütte.
„ Es tut mir leid, von dem Unfall zu hören“, sagte er. „Sie werden Captain Helding in diesem Raum finden.“
Zum zweiten Mal nahm Wardour, mit sonderbarer Hartnäckigkeit, die Unterhaltung mit Frank auf.
„ So kannten Sie die Burnhams?“ sagte er. „Was wurde aus Clara, als ihr Vater starb?“
Franks Gesicht erglühte augenblicklich vor Wut.
„ Clara!“ wiederholte er. „Was gibt Ihnen das Recht, von Miß Clara auf diese vertrauliche Weise zu sprechen?“
Wardour ergriff die Gelegenheit, um Streit mit ihm anzufangen.
„ Welches Recht haben Sie, zu fragen?“ gab er derb zurück.
Franks Blut war in Wallung. Er vergaß sein Versprechen an Clara, ihre Verlobung geheimzuhalten – er vergaß alles außer der zügellosen Unverschämtheit von Wardours Ausdrucksweise und Verhalten.
„ Ein Recht, das zu respektieren ich von Ihnen ausdrücklich verlange“, antwortete er. „Das Recht, mit ihr verlobt zu sein.“
Crayfords zuverlässige Augen waren noch immer wachsam, und Wardour fühlte sie auf sich gerichtet. Ein wenig mehr, und Crayford würde sich offen einmischen. Sogar Wardour sah ausnahmsweise die Notwendigkeit ein, sein Temperament zu kontrollieren, koste es ihn, was es wolle. Er entschuldigte sich mit überspannter Freundlichkeit bei Frank.
„ Unmöglich, solch ein Recht wie das Ihre in Zweifel zu ziehen“, sagte er. „Vielleicht werden Sie mich entschuldigen, wenn Sie wissen, daß ich einer von Miß Burnhams alten Freunden bin. Mein Vater und ihr Vater waren Nachbarn. Wir sind einander immer wie Bruder und Schwester begegnet–“
An dieser Stelle unterbrach Frank die Entschuldigung freundlich.
„ Sagen Sie nichts mehr“, warf er ein. „Ich war im Unrecht – ich bin in Wut geraten. Bitte vergeben Sie mir.“
Während er sprach, schaute Wardour ihn mit einem seltsamen, widerwilligen Interesse an. Als er fertig war, stellte Wardour eine außergewöhnliche Frage.
„ Ist sie sehr verliebt in Sie?“
Frank brach in Lachen aus.
„ Mein lieber Kamerad“, sagte er, „kommen Sie zu unserer Hochzeit, und urteilen Sie selbst.“
„ Zu Ihrer Hochzeit kommen?“ Als er die Worte wiederholte, warf Wardour einen verstohlenen Blick auf Frank, welchen Frank (der damit beschäftigt war, sich seinen Rucksack umzuschnallen) übersah. Crayford bemerkte ihn, und Crayford gruselte es. Die Worte, welche Wardour zu ihm gesagt hatte, während sie allein miteinander gewesen waren, mit jenen Worten vergleichend, die soeben gefallen waren, konnte er nur einen Schluß ziehen. Die Frau, die Wardour geliebt und verloren hatte, war Clara Burnham. Der Mann, der sie ihm geraubt hatte, war Frank Aldersley. Und Wardour hatte es in der Zwischenzeit, seit sie einander das letzte Mal getroffen hatten, herausgefunden. ‚Gott sei Dank’, dachte Crayford, ‚daß die Würfel sie getrennt haben! Frank geht mit der Expedition, und Wardour bleibt bei mir zurück.’
Der Gedanke war ihm kaum in den Sinn gekommen – Franks gedankenlose Einladung war diesem just über seine Lippen gekommen – als die Segeltuchwand vor dem Zugang beiseite gezogen wurde. Captain Helding und die Offiziere, die mit dem Erkundungskommando fortgehen sollten, kamen zurück in den Hauptraum auf ihrem Weg hinaus. Als er Crayford sah, hielt Captain Helding an, um mit ihm zu sprechen.
„ Ich habe einen Unglücksfall zu melden“, sagte der Captain, „welcher unsere Anzahl um einen verringert. Mein zweiter Lieutenant, der dem Erkundungskommando beitreten sollte, ist auf dem Eis gestürzt. Nach dem zu urteilen, was der Quartiermeister mir mitgeteilt hat, befürchte ich, daß der arme Bursche sich das Bein gebrochen hat.“
„ Ich werde seine Stelle einnehmen“, rief eine Stimme am anderen Ende der Hütte. Alle schauten sich um. Der Mann, der gesprochen hatte, war Richard Wardour.
Crayford trat augenblicklich dazwischen – so vehement, daß er alle erstaunte, die ihn kannten.
„ Nein!“, sagte er. „Nicht du, Richard! nicht du!“
„ Warum nicht?“ fragte Wardour hart.
„ In der Tat, warum nicht?“ fügte Captain Helding hinzu. „Wardour ist genau der Mann, der auf einem langen Marsch nützlich sein kann. Er ist bei vollkommener Gesundheit, und er ist der beste Schütze unter uns. Ich war eben im Begriff, ihn selbst vorzuschlagen.“
Crayford war es unmöglich, seinen üblichen Respekt vor seinem vorgesetzten Offizier zu zeigen. Er zog den Entschluß des Captains offen in Zweifel.
„ Wardour hat kein Recht, sich freiwillig zu melden“, entgegnete er. „Es wurde vereinbart, Captain Helding, daß der Zufall entscheiden sollte, wer gehen und wer bleiben soll.“
„ Und der Zufall hat es entschieden“, rief Wardour. „Beabsichtigst du, daß wir die Würfel noch mal werfen sollen, und einem Offizier der Seemöwe eine Chance geben, einen Offizier der Wanderer zu ersetzen? Es gibt in unserer Gruppe eine freie Stelle, nicht in eurer; und wir machen das Recht geltend, die Stelle auszufüllen, wie wir es für richtig halten. Ich melde mich freiwillig, und mein Captain unterstützt mich. Wessen Autorität kann mich davon abhalten?“
„ Sachte, Wardour“, sagte Captain Helding. „Ein Mann, der im Recht ist, kann es sich erlauben, mit Mäßigung zu sprechen.“ Er wandte sich an Crayford. „Sie müssen sich eingestehen“, fuhr er fort, „daß Wardour diesmal recht hat. Der fehlende Mann gehört zu meinem Kommando, und nach dem üblichen Recht sollte einer meiner Offiziere seinen Platz ausfüllen.“
Es war unmöglich, die Sache weiter zu disputieren. Selbst der dümmste anwesende Mann würde sehen können, daß die Erwiderung des Captains unbestreitbar war. In gänzlicher Verzweiflung nahm Crayford Franks Arm und führte ihn einige Schritte beiseite. Die letzte Chance, die beiden Männer zu trennen, war die Chance, an Frank zu appellieren.
„ Mein lieber Junge“, begann er, „ich möchte dir einige freundliche Worte in Bezug auf deine Gesundheit sagen. Ich habe bereits, wenn du dich erinnerst, meine Zweifel ausgedrückt, ob du kräftig genug bist, um eines der Erkundungskommandos mitzumachen. Gerade jetzt habe ich stärkere Zweifel denn je. Wirst du den Rat eines Freundes annehmen, der dir Gutes wünscht?“
Wardour war Crayford gefolgt. Wardour trat barsch dazwischen, bevor Frank etwas erwidern konnte.
„ Laß ihn in Ruhe!“
Crayford schenkte der Unterbrechung keine Beachtung. Ihm war zu inständig daran gelegen, Frank von der Expedition abzuziehen, um irgend etwas zu bemerken, was von den Personen um ihn herum gesagt oder getan wurde.
„ Nicht, bitte riskiere nicht die Härten, welche auszuhalten du nicht imstande bist“, fuhr er flehentlich fort. „Deine Stelle kann leicht ausgefüllt werden. Ändere deine Meinung, Frank. Bleib hier bei mir.“
Wieder mischte sich Wardour ein. Wieder rief er aus „Laß ihn in Ruhe!“, barscher als zuvor. Noch immer taub und blind gegen jegliche Überlegung außer einer, drängte Crayford Frank seine dringende Bitte auf.
„ Du hast gerade eben bekannt, daß du nicht sehr an Strapazen gewöhnt bist“, beharrte er. „Du spürst doch – du mußt spüren – wie schwach die letzte Krankheit dich zurückgelassen hat? Du weißt – ich bin sicher, daß du weißt – wie wenig du fähig bist, dem Erfrieren in dieser Kälte sowie langen Märschen über den Schnee zu trotzen.“
Verärgert über das Erträgliche hinaus ob Crayfords Hartnäckigkeit, und Anzeichen des Nachgebens in Franks Gesicht sehend, oder glaubend, sie zu sehen, vergaß sich Wardour so weit, daß er Crayford am Arm packte und versuchte, ihn von Frank wegzuzerren. Crayford wandte sich um und sah ihn an.
„ Richard“, sagte er, sehr leise, „du bist nicht du selbst. Ich bemitleide dich. Senke deine Hand.“
Wardour lockerte seinen Griff, mit etwas von dem widerspenstigen Gehorsam eines wilden Tieres gegenüber seinem Wärter. Die momentane Stille, die folgte, gab Frank schließlich die Gelegenheit, zu sprechen.
„ Ich bin mir dankbar des Interesses bewußt, Crayford“, begann er, „welches du an mir hast—“
„ Und du wirst meinem Rat folgen?“ warf Crayford ungeduldig ein.
„ Ich habe mich entschlossen, alter Freund“, antwortete Frank, bestimmt und traurig. „Vergib mir, daß ich dich enttäusche. Ich bin für die Expedition bestimmt. Ich gehe mit der Expedition.“ Er trat näher zu Wardour. In seiner Arglosigkeit ob jeglichen Verdachts klopfte er Wardour herzlich auf die Schulter. „Wenn ich Erschöpfung spüre“, sagte der arme, einfältige Frank, „werden Sie mir helfen, Kamerad – nicht wahr? Kommen Sie mit!“
Wardour schnappte sein Gewehr aus den Händen des Seemannes, der es für ihn getragen hatte. Sein finsteres Gesicht erstrahlte plötzlich in einer schrecklichen Freude.
„ Kommt!“ rief er. „Über den Schnee und übers Eis! Kommt! Wohin keine menschlichen Fußstapfen jemals geschritten sind, und wo keine menschliche Spur jemals zurückgeblieben ist.“
Blindlings, instinktiv, machte Crayford einen Versuch, sie zu trennen. Seine Offizierskameraden, die in der Nähe standen, zogen ihn zurück. Sie schauten einander besorgt an. Die gnadenlose Kälte, die ihre Opfer auf verschiedene Arten befiel, hatte in einigen Fällen zuerst ihren Verstand befallen. Jeder hatte Crayford gern. Geriet er ebenfalls auf den finsteren Pfad, den andere vor ihn eingeschlagen hatten? Sie zwangen ihn, sich auf eine der Truhen zu setzen. „Ruhig, alter Junge“, sagten sie freundlich, – „ruhig!“ Crayford fügte sich; innerlich wand er sich unter dem Gefühl seiner eigenen Hilflosigkeit. Was in Gottes Namen konnte er tun? Konnte er Wardour vor Captain Helding auf alleinigen Verdacht hin denunzieren – ohne viel mehr als den Schatten eines Beweises, um zu rechtfertigen, was er sagte? Der Captain würde es ablehnen, einen seiner Offiziere zu beleidigen, indem er ihn auch noch auf die ungeheuerliche Beschuldigung ansprach. Der Captain würde folgern, wie andere bereits gefolgert hatten, daß Crayfords Verstand nachließe unter den Unbilden der Kälte und Entbehrungen. Keine Hoffnung – buchstäblich keine andere Hoffnung gab es jetzt, außer in der Anzahl der Expeditionsteilnehmer. Offiziere und Matrosen, sie alle mochten Frank. So lange, wie sie Hand oder Fuß bewegen konnten, würden sie ihm unterwegs helfen – sie würden dafür sorgen, daß ihm nichts Böses widerfuhr.
Die Anweisung war erteilt worden; die Tür wurde aufgestoßen; die Hütte leerte sich schnell. Über dem gnadenlosen weißen Schnee – unter dem gnadenlosen schwarzen Himmel – begann sich das Erkundungskommando in Bewegung zu setzen. Die kranken und hilflosen Männer, jene, deren letzte Hoffnung auf Rettung sich auf ihre fortgehenden Kameraden konzentrierte, spendeten schwach Beifall. Einige wenige, deren Tage gezählt waren, schluchzten und weinten wie Frauen. Franks Stimme schwankte, als er sich noch einmal umwandte an der Tür, um seine letzten Worte zu dem Freund zu sagen, der ein Vater für ihn gewesen war.
„ Gott segne dich, Crayford!”
Crayford machte sich los von den Offizieren neben ihm, eilte vorwärts, und faßte Frank bei beiden Händen. Crayford hielt ihn, als ob er ihn niemals gehen lassen wollte.
„ Gott behüte dich, Frank! Ich würde alles, was ich auf der Welt habe, geben, um bei dir sein zu können. Lebwohl! Lebwohl!“
Frank winkte mit der Hand – wischte hastig die Tränen fort, die sich in seinen Augen sammelten – und eilte hinaus. Crayford rief ihm die letzte, die einzige Warnung nach, die er geben konnte:
„ Solange du stehen kannst, bleibe beim Hauptkorps, Frank!“
Wardour, der bis zuletzt wartete – Wardour, der Frank durch das Schneetreiben folgte – hielt an, ging zurück, und antwortete Crayford an der Tür:
„ Solange er stehen kann, bleibt er bei mir.“
Vorheriges Kapitel
Nächstes Kapitel
Inhaltsverzeichnis für diese Geschichte
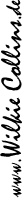
 Startseite
Startseite
 Neuigkeiten
Neuigkeiten Inhaltsverzeichnis aktuelle
Übersetzung
Inhaltsverzeichnis aktuelle
Übersetzung