
Amors Pfeil
I
Die Szenerie ist eine berühmte Stadt in Schottland.
Die Hauptperson ist der beste Polizeibeamte, den wir zu der Zeit, als ich das Amt des Landvogts bekleidete, hatten.
Er war ein alter Mann und kurz vor seinem Ruhestand zu der Zeit, in der meine Erzählung spielt. Der Diebstahl eines unschätzbaren Bildes, welches sich der Entdeckung der anderen Polizeibeamten entzogen hatte, brachte den alten Benjamin Parley dazu, ein letztes Mal tätig zu werden. Geld war nicht der Beweggrund, der ihn hauptsächlich dazu trieb, obwohl die hohe Belohnung, die für die Wiederbeschaffung des Bildes angeboten wurde, verdoppelt worden war. »Wenn der Rest von euch den Dieb nicht fassen kann«, sagte er, »muss ich den Fall in die Hand nehmen - für die Ehre von Schottland.«
Nachdem er diese Entscheidung gefällt hatte, stellte sich Parley bei mir daheim vor. Ich gab ihm ein Empfehlungsschreiben für den Eigentümer des Bildes mit – der damals im Begriff stand, nach London um Hilfe zu ersuchen.
Man hat sicher von Lord Daltons berühmter Galerie gehört. Eine Madonna von Raphael war das Juwel der Sammlung. Eines Morgens entdeckten die Diener in der Frühe den leeren Rahmen, ohne eine Spur zu finden, wie der kühne Raub begangen worden war. Nachdem er unserem altgedienten Beamten gestattet hatte, seine eigenen Voruntersuchungen zu machen, war Mylord (ein Mann von seltener Begabung und einem bezeichnenden eigenwilligen Charakter) sofort beeindruckt von der überraschenden neuen Schlussfolgerung, zu der Parley gekommen war und auch von der waghalsigen Natur des Plans, den er erdacht hatte, um das Geheimnis des Diebstahls aufzuklären.
Lord Dalton zeigte auf einen Brief auf dem Bibliothekstisch, der an den Chief der Londoner Polizeikräfte gerichtet war.
»Ich werde dessen Versand um eine Woche verzögern«, sagte er. »Wenn Sie mir nach Ablauf der Zeit einen vielversprechenden ersten Bericht liefern, soll der Fall uneingeschränkt Ihren Händen überlassen werden.«
Am Ende der Woche schickte Parley den Bericht. Lord Dalton vernichtete zuerst den Brief an London und sprach dann mit Parley bezüglich der Belohnung.
»Als ein gut unterrichteter Polizeibeamter«, sprach er, »sind Sie sich ohne Zweifel bewusst, dass ich einer der reichsten Männer Schottlands bin. Haben Sie auch gehört, ich wäre ein geiziger Mann?«
»Ich habe genau das Gegenteil gehört, Mylord«, antwortete Parley vollkommen wahrheitsgetreu.
»Sehr gut. Sie werden geneigt sein, mir zu glauben, wenn ich Ihnen erzähle, dass der Geldwert meines Bildes (so hoch er auch ist) in meiner Einschätzung der geringste Teil seines Wertes ist. Der Landvogt sagte mir, Sie hätten eine Frau und zwei Töchter daheim und dass Sie im Begriff standen, pensioniert zu werden, als Sie Ihre Dienste anboten. Bei Ihrem Alter muss ich diesen Umstand in Betracht ziehen. Macht es Ihnen etwas aus, mir zu sagen, welches Einkommen Sie erwarten dürfen, wobei Sie Ihre anderen Geldmittel (falls Sie welche haben) zu Ihrer Pension hinzufügen?«
Parley beantwortete die Frage ohne Zögern und ohne Zurückhaltung. Er war kein Mann, den man leicht in Erstaunen versetzte; aber Lord Daltons nächste Worte verschlugen ihm buchstäblich die Sprache.
»Setzen Sie meinen Raphael wieder innerhalb eines Monats von heute an in den Rahmen ein«, sagte Seine Lordschaft, »und ich werde Ihr Einkommen verdreifachen und es nach Ihrem Ableben Ihrer Witwe und Ihren Kindern zukommen lassen.«
In weniger als drei Wochen von diesem Tage an spazierte Benjamin Parley (der soeben aus Brüssel gekommen war) in die Gemäldegalerie und setzte den Raphael mit seinen eigenen Händen wieder in den Rahmen ein. Er weigerte sich, zu sagen, wie er das Bild wiederbeschafft hatte. Aber er verkündete, wobei er sich den Anschein gab, sich selbst Vorwürfe zu machen, welcher völlig darin fehlschlug, Lord Dalton zu täuschen, die unglückliche Flucht des Gefangenen bei der Reise nach Schottland. Später ging hinter vorgehaltener Hand das Gerücht um, dass dieser selbige Gefangene ein Landstreicher sei, der mit der Familie des Lords verwandt war, und dass Parley seinen Erfolg zuallererst seinem verständigen Mut zu verdanken habe, es zu wagen, den Verwandten eines Edelmannes zu verdächtigen. Ich weiß nicht, was andere Leute erlebt haben. Ich für meinen Teil habe festgestellt, dass in Gerüchten ab und zu ein Körnchen Wahrheit steckt.

II
Während ich die Umstände erwähnte, die den großzügigen Adligen und den befähigten Polizeibeamten miteinander bekannt machten, habe ich an gewisse darauffolgende Ereignisse gedacht, deren Bedeutung man noch schätzen müssen wird. Es sollte sich herausstellen, dass der Tag, an dem Benjamin Parley seine prächtige Belohnung erhielt, der verhängnisvolle Tag seines Lebens sein sollte.
Er hatte ursprünglich geplant, sich in das Dorf in Pentshire, in dem er geboren worden war, zurückzuziehen. Da er nun im Besitz eines Einkommens war, das ihn befähigte, den ehrgeizigen Bestrebungen seiner Frau und seiner Töchter nachzugeben, beschloss man, dass er seinen Wohnsitz in einen der Vororte von London verlagern sollte. Mrs. Parley und ihre zwei Töchter, die sich nun in einer »vornehmen Villa« etabliert hatten, nahmen die Stellung von »Ladies« an und der alte Benjamin war keine halbe Stunde Spaziergang von seinen Kollegen in der Polizeistation entfernt, falls ihn die Freizeit zu übermannen drohte. »Aber ohne die Großzügigkeit Mylords«, bemerkte seine Frau, »hätte er niemals das Geld dafür gehabt. Wenn wir nach Pentshire gegangen wären, hätte er aller Wahrscheinlichkeit nach unsere Stadt nie wieder gesehen.«
Um einem einen Eindruck von dem ausgezeichneten Charakter und von der hohen Wertschätzung zu geben, in welchen dieser arme Kerl verdientermaßen gehalten wurde, mag ich erwähnen, dass sein Ruhestand mit der Darlegung eines Zeugnisses begangen wurde. Es nahm die kuriose Form einer quittierten Rechnung an, die die Ausgaben repräsentierte, welche sich darauf beliefen, sein neues Haus zu möblieren. Ich führte den Vorsitz bei diesem Treffen. Der Landadel, die Anwälte und die Händler waren in großer Zahl anwesend; alle gleichermaßen begierig darauf, einem Mann ihren Respekt zu zollen, der in einer Position, die von Versuchungen heimgesucht wurde, von Anfang bis Ende ein Beispiel von unbestechlicher Unbescholtenheit abgegeben hatte.
Einige Familienangelegenheiten nötigten mich zu dieser Zeit, mich beurlauben zu lassen. Zwei Monate lang wurden meine Aufgaben von meinem Stellvertreter durchgeführt.
Als ich bei meiner Rückkehr die Briefe und Karten durchsah, welche meinen Schreibtisch bedeckten, fand ich ein Stück Papier mit einigen mit Bleistift geschriebenen Zeilen, welches von Parleys Frau unterzeichnet war. »Wenn Sie kurz Zeit erübrigen können, Sir, bitte seien Sie so gut und lassen Sie mich Ihnen ein Wort sagen – in Ihrem Haus.«
Die Handschrift zeigte eindeutige Zeichen der Aufregung; und die letzten drei Worte waren unterstrichen. Lastete ein Geheimnis auf der guten Frau? Und war es ihrem Ehemann und ihren Kindern nicht gestattet, in ihr Vertrauen gezogen zu werden?
Ich war nach meiner Abwesenheit so eifrig beschäftigt, dass ich eine Verabredung mit Mrs Parley nur zur Frühstückszeit ausmachen konnte. Die Stunde war so früh, dass sie sicher sein würde, mich allein vorzufinden.
In dem Moment, als sie das Zimmer betrat, bemerkte ich eine Veränderung an ihr, die mich auf etwas ernstes vorbereitete. Es mag vielleicht erwünscht sein, eine gewisse Neigung zu Aufregung und Übertreibung in Mrs. Parleys Art, zu denken und zu sprechen, damit zu erklären, dass sie Waliserin war.
»Stimmt irgendetwas daheim nicht?« fragte ich.
Sie begann zu weinen. »Sie wissen, wie stolz ich auf unser großes Haus und unser glänzendes Einkommen war, Sir. Ich wünschte, wir wären dorthin gegangen, wo wir zuerst hingehen wollten – hunderte Meilen weg von diesem Ort! Ich wünschte, Parley hätte seine Lordschaft nie getroffen und nie die große Belohnung verdient!«
»Sie wollen mir doch nicht erzählen«, sagte ich, »dass Sie und Ihr Ehemann sich gestritten haben?«
»Schlimmer, Sir – schlimmer als das. Parley ist so verändert, dass mein eigener Mann wie ein Fremder für mich ist. Um Himmels willen, sagen Sie nichts! In meinem hohen Alter, nachdem man dreißig Jahre und mehr zusammen geschlafen hat, bin ich abgetragen. Parley hat sein Schlafzimmer und ich habe meins!« Sie sah mich an – und errötete. Mit fast sechzig Jahren errötete das arme Wesen wie ein junges Mädchen!
Es ist unnötig, zu sagen, dass mir die berühmte Frage des französischen Philosophen auf der Zungenspitze lag: »Wer ist sie?« Aber ich schuldete es Parleys makellosem Ruf, zu zögern, bevor ich auf eine Meinung wie diese einging. Die Frage der Betten war eindeutig außerhalb meines Zuständigkeitsbereichs. »In welch anderer Art scheint Parley sich verändert zu haben?« fragte ich nach.
»Scheint?« wiederholte sie. »Sogar die Mädchen bemerken es! Sie sagen, ihr Vater kümmert sich jetzt nicht mehr um sie. Und es ist wahr! Bei unserem gegenwärtigen Reichtum können wir es uns leisten, eine Gouvernante zu zahlen; und als wir uns in unserem neuen Haus einrichteten, stimmte Parley mir zu, dass die armen Dinger besser unterrichtet werden sollten. Er hat all sein Interesse an ihrem Wohlergehen verloren. Wenn ich die Angelegenheit vor ihm erwähne, sagt er: »Oh! Nur Scherereien!« und entmutigt mich auf diese Weise. Sie wissen, Sir, er zog sich immer ansehnlich an, entsprechend seiner Stellung und seines Alters. Das hat sich nun alles verändert. Er ist zu einem neuen Schneider gegangen; er trägt fesche Mäntel, geschnitten wie für junge Männer; ich fand ein Gummiband unter seinen Kleidern – so eins, welches angepriesen wird, um das Fett zurückzuhalten und die Figur zu bewahren. Sie waren so lieb, ihm eine Schnupftabaksdose an seinem letzten Geburtstag zu schenken. Sie nützt ihm jetzt nichts mehr. Benjamin hat das Schnupfen aufgegeben.«
Hier hielt ich es im Interesse der guten Mrs. Parley selbst für wünschenswert, den Vortrag ihrer Klagen zu einem Abschluss zu bringen. Die Ehetragödie (um in der Sprache der Bühne zu sprechen) war mir mehr als ausreichend enthüllt. Nach einem beispielhaften Leben war der Modellehemann und -vater einer dieser Versuchungen ausgesetzt gewesen, die besonders mit den Straßen einer großen Stadt verbunden sind – und war ihr am Ende seiner Karriere erlegen. Ein katastrophaler Untergang; nicht ganz und gar beispiellos in der Geschichte des schwächlichen Menschengeschlechts, selbst in einem hohen Alter! Ich war betrübt, aufrichtig betrübt; aber was konnte ich in meiner Stellung tun?
»Ich bin Ihnen zu Diensten«, sagte ich, »wenn Sie mir nur erzählen wollen, wie ich Ihnen beistehen kann.«
»Irgendein Flittchen hat sich Benjamin ergattert«, rief die arme Frau. »Und ich weiß nicht, wo ich sie finden kann. Was soll ich tun? Benjamin ist zu scharfsinnig für mich – Ich glaube, ich werde noch verrückt!«
Sie fiel zurück auf ihren Stuhl und begann, ihre Hände auf ihren Schoß zu schlagen. Hätte ich diese hysterische Aufregung weiter in ihrem gewöhnlichen Entwicklungsverlauf voranschreiten lassen, wäre der Haushalt durch einen Ausbruch von Schreien alarmiert worden. Es gab nur einen Weg, Mrs. Parley zu beruhigen, und ich schlug ihn ein.
»Angenommen, ich spreche mit Ihrem Mann?« schlug ich vor.
»Oh, Herr Landvogt -- !«
In Mrs. Parleys nervöser walisischer Natur drohte sich selbst Dankbarkeit in hysterischer Weise auszudrücken. Ich hielt den neuerlichen Ausbruch auf, indem ich einige notwendige Fragen stellte. Die wenigen Fakten, die ich herauszulocken im Stande war, stellten mein bevorstehendes Gespräch mit dem Ehemann in keinem vielversprechenden Licht dar.
Nach dem Umzug in das neue Haus hatte Parley einige Schwierigkeiten, sich mit der Veränderung in seinem Leben auszusöhnen (was allzu natürlich war). Von Zeit zu Zeit schaute er (wie seine Frau vorgeschlagen hatte) auf der Polizeiwache vorbei und hatte den Nutzen seiner Erfahrung seinen Kollegen angeboten, wenn sie Rat brauchen sollten. Eine Weile lang erzeugten diese Besuche in der Stadt die guten Ergebnisse, die von ihnen erwartet worden waren. Dann folgte der sehr vollständige und sehr verdächtige Wandel mit ihm, von dem mir bereits berichtet worden war. Da Mann und Frau nachts noch dasselbe Zimmer belegten, entdeckte Mrs. Parley, dass Benjamins Schlaf durch Träume gestört wurde. Zum ersten Mal, seit sie ihn kannte, hörte sie ihn im Schlaf sprechen. Hier und dort entschlüpften ihm Worte, die auf eine Frau hinzudeuten schienen – eine Frau, die er »mein Liebes« nannte – eine Frau, die anscheinend irgendein umtriebiges Vertrauen zu ihm erlangt hatte. Unter anderen Umständen vernünftig genug, hatte Mrs. Parleys Eifersucht sie zu einer Tat der Albernheit getrieben. Sie weckte ihren Mann und bestand auf einer Erklärung. Das Ergebnis war die Einrichtung getrennter Schlafzimmer gewesen – unter dem Vorwand, dass Parleys Ehepflichten ihm es nicht erlauben würden, die Ruhe seiner Frau auf diese Art zu stören. Allzu richtig zu dem Schlusse gelangend, dass er Angst davor hatte, sich selbst zu verraten, hatte Mrs. Parley das verzweifelte Experiment gewagt, ihn heimlich zu verfolgen, sobald er das nächste Mal das Haus verlassen würde. Ein Polizeioffizier mit 40 Jahren Erfahrung und einem Geheimnis, das er schützen will, sieht vor und hinter sich, und nach links und rechts, zu ein und derselben Zeit. Die arme Mrs. Parley, als Spion entlarvt, fühlte den Blick, den ihr Mann ihr sandte (um ihren eigenen Ausdruck zu gebrauchen) »im Mark ihrer Knochen.« Seine Sprache war gleichermaßen beängstigend. »Versuch es noch einmal«, sagte er, »und du wirst das letzte von mir gesehen haben.« Sie hatte natürlich Angst davor, es noch einmal zu versuchen und nun war sie da, an meinem Frühstückstisch, mit nur noch einer einzigen Hoffnung – der Hoffnung, dass der Landvogt ihr beistehen würde!

III
Dies war das Gespräch mit der Ehefrau. Mein Gespräch mit dem Ehemann erzeugte ein Ergebnis, auf welches ich in gewissem Grad vorbereitet war. Es überzeugte mich, dass irgendeine Einmischung meinerseits schlimmer als nutzlos sein würde.
Ich hatte bestimmte Ansprüche auf Parleys Dankbarkeit und Respekt, welche er bisher mit tiefempfundener Aufrichtigkeit anerkannt hatte. Als wir nun von Angesicht zu Angesicht gegenüber standen, sah ich – bevor ein Wort zwischen uns gefallen war – eines eindeutig: mein Einfluss über ihn war verloren.
Um Mrs. Parleys willen konnte ich mir selbst nicht erlauben, schon zu Anfang entmutigt zu sein.
»Ihre Frau war gestern in großer Verzweiflung bei mir«, sagte ich.
Seine Stimme sagte mir, dass er heftig gelitten hatte – und immer noch litt. Ich bemerkte ebenso, dass die durch das Alter gezeichneten Falten in seinem Gesicht tiefer geworden waren. Er fühlte offensichtlich, dass er als ein Mann vor mir stand, der sich in seinem hohen Alter selbst zugrunde gerichtet hatte. Andererseits war es aber auch deutlich, dass er entschlossen war, mich zu täuschen, sollte ich versuchen, sein Geheimnis zu lüften.
Meine einzige Chance, den richtigen Eindruck zu erzeugen, lag darin, an sein Selbstwertgefühl zu appellieren, wenn noch ein solches in ihm vorhanden war.
»Nehmen Sie nicht an, dass ich zwischen Ihnen und Ihrer Frau vermitteln werde«, fuhr ich fort. »Bei dem wenigen, was ich Ihnen jetzt zu sagen habe, werde ich den guten Ruf berücksichtigen, welchen Sie immer unterhalten haben, nicht nur unter Ihren eigenen Freunden, sondern auch unter Personen wie mir selbst, die über sie gestellt sind durch den Zufall der Geburt oder der Stellung.«
»Sie sind sehr nett, Sir. Ich versichere Ihnen, ich fühle -«
Er stockte. Ich wartete, um ihn fortfahren zu lassen. Er schlug seine Augen vor mir nieder. Er schien Angst davor zu haben, der guten Regung zu folgen, die ich in ihm geweckt hatte. Ich versuchte es noch einmal.
»Ohne zu wiederholen, was Mrs. Parley zu mir sagte«, fuhr ich fort, »mag ich Ihnen erzählen, zu welchem Schluss ich selbst gelangt bin. Man wird Ihnen nur gerecht, wenn man annimmt, dass Ihre Frau durch den Augenschein fälschlicherweise getäuscht wurde. Werden Sie zu ihr zurückgehen und sie davon überzeugen, dass sie sich geirrt hat?«
»Sie würde mir nicht glauben, Sir.«
»Werden Sie wenigstens den Versuch wagen?«
Er schüttelte hartnäckig den Kopf. »Völlig nutzlos« antwortete er. »Das Temperament meiner Frau -«
Ich unterbrach ihn hier.
»Tragen Sie dem Temperament Ihrer Frau Rechnung«, sagte ich, »und vergessen Sie nicht, dass Sie Ihren Töchtern Rücksichtnahme schulden. Ersparen Sie ihnen die Scham und die Qual, ihren Vater und ihre Mutter feindselig gegeneinander zu sehen.«
Seine Miene änderte sich: ich hatte etwas gesagt, was ihn zuversichtlich werden ließ.
»Sagte meine Frau irgendetwas zu Ihnen über unsere Mädchen?« fragte er.
»Ja.«
»Was hat sie gesagt?«
»Sie hielt Sie für nachlässig gegenüber Ihren Töchtern.«
»Noch etwas, Sir?«
»Sie sagte, Sie hätten einst zugestimmt, dass die Mädchen eine gute Gouvernante haben sollten; aber sie denkt nun, Sie seien gleichgültig ob der besten Interessen Ihrer Kinder.«
Er erhob eine seiner Hände mit einer theatralischen Übertreibung dieser Geste, die ich noch nie bei ihm erlebt hatte.
»Das hat sie gesagt, oder? Nun, Herr Landvogt, urteilen Sie selbst, was die Klagen meiner Frau über mich wert sind! Ich habe heute eine Gouvernante für unsere Kinder eingestellt.«
Ich sah ihn an.
Ein weiteres Mal schlug er die Augen vor mir nieder.
»Weiß Mrs. Parley, was Sie getan haben?« fragte ich nach.
»Sie soll es wissen«, antwortete er laut, fast schon unverschämt, »wenn ich nach Hause komme.«
»Ich bin Ihnen verbunden, dass Sie hierher gekommen sind, Mr. Parley. Lassen Sie mich Sie nicht länger aufhalten.«
»Bedeutet das, dass Sie missbilligen, was ich getan habe, Sir?«
»Ich äußere keine Meinung.«
»Bedeutet das, Sie zweifeln am Charakter der Gouvernante?«
»Es bedeutet, dass ich bedaure, Ihnen Unannehmlichkeiten bereitet zu haben, hierher zu kommen – und dass ich nichts mehr zu sagen habe.«
Er ging zur Tür – öffnete sie – zögerte – und kam zu mir zurück.
»Ich bitte Sie um Entschuldigung, Sir, wenn ich in irgendeiner Weise grob mit Ihnen gesprochen habe. Sie werden vielleicht verstehen, dass ich in Gedanken etwas aufgewühlt bin.« Er dachte nach und nahm aus seiner Tasche die Schnupftabakdose, die seine Frau erwähnt hatte. »Ich habe die Angewohnheit, zu schnupfen, aufgegeben, Sir. Sie ist liederlich und – und nicht gut für die Gesundheit. Aber ich fühle mich nicht weniger geehrt durch Ihr Geschenk. Ich werde es dankbar würdigen, solange ich lebe.«
Er wandte seinen Kopf ab – aber nicht schnell genug, um die Tränen zu verstecken, die seine Augen füllten. Für einen Augenblick hatte alles, was das beste und wahrhaftigste in Benjamin Parleys Natur war, sich zum Ausdruck gebracht. Aber der Teufel, der von ihm Besitz ergriffen hatte, war nicht auszutreiben. Er war tief beschämt ob der guten Regung, die ihm zur Ehre gereicht hatte. »Die Sonne ist sehr hell heute morgen«, murmelte er verwirrt, »meine Augen sind ziemlich schlecht, Sir. Ich wünsche Ihnen guten Morgen.«

IV
Wieder allein zog ich an der Klingel und gab dem Bediensteten seine Anweisungen. Wenn Mr. oder Mrs. Parley wieder beim Haus vorbeischauen würden, so sollte Ihnen gesagt werden, dass ich sie nicht sehen konnte.
War dies eine raue Tat meinerseits? Man lasse uns der Angelegenheit ordentlich ins Gesicht blicken und sehen, was folgt.
Es ist möglich, dass einige Personen, die nicht meine Erlebnisse mit den schlimmsten Gesichtspunkten der menschlichen Natur teilen, geneigt sein könnten, Mrs. Parleys Verdächtigungen ihrem eifersüchtigen Temperament zuzuschreiben und die nicht unwillig sein könnten, zu denken, dass ihr Ehemann eine Gouvernante für ihre Kinder in vollkommen gutem Glauben eingestellt hatte. Keine solch barmherzige Sichtweise der Angelegenheit stellte sich meinem Verstand dar. Nichts konnte klarer für mich sein, als dass Parley ein Werkzeug in den Händen einer verwegenen und verruchten Frau war; die ihn dazu verleitet hatte, aus ihren eigenen Gründen eine Tat zu begehen, die nichts weniger war als eine Schandtat an seiner Frau. Zu welchem Zweck konnte ich mich einmischen? Die einzige Person, die der armen Mrs. Parley helfen konnte, musste mit der Autorität der Verwandtschaft gerüstet sein. Und, selbst in diesem Fall, was für ein gutes Ergebnis konnte erwartet werden, wenn die Frau ihre Rolle als Gouvernante verständig spielte und wenn Parley dicht hielt? Eine hoffnungslosere Aussicht hatte sich mir nie geboten. Es ärgerte und beschämte mich, mich selbst hilflos auf Ereignisse wartend vorzufinden. Was konnte ich sonst tun?
Am nächsten Tag kam Mrs. Parley vorbei und der Bedienstete befolgte seine Anweisungen.
Am Tag darauf (mit der entschuldbaren Hartnäckigkeit einer Frau in Verzweiflung) schrieb sie mir.
Der Brief ist schon lange zerstört; aber sein Inhalt bleibt mir in Erinnerung. Er unterrichtete mich, dass sich die Gouvernante tatsächlich im Haus eingerichtet hatte; und beschrieb sie, unnötig zu erwähnen, als die schamloseste Teufelin, die je den Hauch des Lebens geatmet hatte. Als Parley gefragt wurde, ob er Referenzen bezüglich ihres Charakters eingeholt hatte, hatte er geantwortet, dass er alt genug wäre, um zu wissen, wie man eine Gouvernante engagiere: dass er sich weigerte, impertinente Fragen zu beantworten und dass er "Miss Beaumont" (dies war der wohlklingende Name der Dame) instruiert hatte, seinem Beispiel zu folgen. Sie hatte bereits verstanden, sich den Weg ins Vertrauen ihrer zwei unschuldigen Schülerinnen zu stehlen und einen günstigen Eindruck auf einen Besucher zu erzeugen, der an diesem Morgen im Haus vorbeigeschaut hatte. In einem Wort, Mrs. Parley war laut eigener Aussage nicht mehr zu helfen. Wie ich erwartet hatte, spielte die falsche Gouvernante ihre Rolle mit Verstand und der vernarrte Ehemann machte seine Autorität geltend.
Zehn Tage später geschah es, dass ich durch die Vororte unserer Stadt fuhr und ich entdeckte Mrs. Parley im vertraulichen Gespräch mit einem der jungen Mitglieder der Geheimpolizei namens Butler. Sie gingen langsam einen abgelegenen Pfad entlang spazieren, welcher an die Hochstraße anschloss; anscheinend waren sie so vertieft in dem, was sie einander zu sagen hatten, dass sie es versäumten, mich zu bemerken, obwohl ich dicht an ihnen vorüberging.
Am nächsten Morgen fand sich Butler bei mir im Büro ein und bat um Erlaubnis, mit mir zu sprechen. Da ich an diesem Tag beschäftigt war, sandte ich eine Nachricht zurück, in der ich ihn fragte, ob die Angelegenheit von Wichtigkeit sei. Die Antwort war "Von äußerst schwerwiegender Wichtigkeit." Er wurde sofort in mein Privatzimmer vorgelassen.

V
Das wenige, was ich über diesen jungen Polizeioffizier gehört hatte, stellte ihn als einen »aufstrebenden Mann« dar, entschlossen und raffiniert, und nicht sehr pingelig dabei, seinen eigenen Vorteil zu nutzen. »Durchaus nützlich, aber braucht Betreuung«. So beschrieb der Superintendent in kurzer Form Mr. Butler.
Ich warnte ihn zu Beginn vor, dass ich nur wenig Zeit entbehren konnte. »Sagen Sie, was notwendig ist, aber in wenigen Worten. Was wollen Sie von mir?«
»Was ich von Ihnen will, Sir, steht in Verbindung mit etwas, das im Haus von Benjamin Parley geschehen ist. Er hat sich selbst in ernste Schwierigkeiten gebracht.«
Ich hätte einen schlechten Geheimpolizisten abgegeben. Wenn ich irgendetwas höre, was mich interessiert oder mich erregt, hat mein Gesicht die Angewohnheit, das zuzugestehen. Butler hatte mich kaum ansehen müssen, um zu sehen, dass er gewisse Erklärungen übergehen konnte, die er hätte zuvor anführen wollen.
»Mrs. Parley sagte mir, Sir, dass Sie ihrem Ehemann erlaubt hatten, mit Ihnen zu sprechen. Kann ich es als gegeben ansehen, dass Sie von der Gouvernante wissen? Parley traf die Frau auf der Straße. Er war von ihrer persönlichen Erscheinung beeindruckt; er kam ins Gespräch mit ihr; er nahm sie in ein Restaurant mit und zahlte ihr ein Abendessen; er hörte ihre interessante Geschichte; er verliebte sich in sie, wie ein höllischer, alter Narr – oh, ich bitte Sie um Entschuldigung!«
»Es ist völlig unnötig, sich zu entschuldigen, Butler. Als er der Frau erlaubte, Gouvernante seiner Kinder zu sein, verhielt er sich sowohl wie ein Halunke als auch wie ein Narr. Fahren Sie fort. Sie haben natürlich entdeckt, welches Ziel sie damit verfolgte, sich in Parleys Haus einzunisten?«
»Ich werde Sie zuerst um Erlaubnis bitten, zu erzählen, wie ich die Entdeckung gemacht habe.«
»Warum?«
»Weil Sie nicht glauben werden, wer die Frau wirklich ist, wenn ich sie nicht vorderhand überzeuge, dass ich keinen Fehler begangen habe.«
»Ist sie eine Berühmtheit?«
»Sie ist überall dort bekannt, wo eine Zeitung herausgegeben wird.«
»Und verbirgt sich natürlich«, sagte ich, »unter einem angenommenen Namen?«
»Und außerdem, Sir, wäre man ihr nie auf die Schliche gekommen – wäre nicht die Eifersucht der Ehefrau gewesen. Jeden außer dieser alten Frau hatte man bequatscht, Miss Beaumont zu mögen. Mrs. Parley glaubte, dass die charmante Gouvernante eine Betrügerin sei und, entschieden, sie bloßzustellen, bat mich um Rat. Das einzige Indiz, das mich verleitete, mir die Angelegenheit anzusehen, kam von dem Dienstmädchen. Miss Beaumonts Schlafzimmer war an der Hinterseite des Hauses. Eines Nachts hörte die Dienerin sie leise das Fenster öffnen und sah sie ihr Handwaschbecken in den Garten entleeren. Die herkömmlichen Mittel, ihr Waschbecken zu leeren, waren natürlich in ihrem Zimmer bereitet. Haben Sie schon mal in das Ankleidezimmer eines Schauspielers gesehen, wenn er fertig mit seiner Arbeit auf der Bühne war, Sir?«
»Manchmal.«
»Haben Sie zufällig das Waschbecken angesehen, wenn er sein Gesicht wusch, bevor er nach Hause ging?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»In solchen Fällen hinterlässt der Schauspieler, was Sie die Schattierung seiner Hautfarbe nennen können, im Wasser, und die Farbe könnte einer aufmerksamen Person auffallen. Wenn ich nicht mein Leben auf der Bühne begonnen hätte, wäre es nie geschehen, dass ich Miss Beaumonts Grund, ihr Waschbecken im geheimen zu leeren, mit einer falschen Hautfarbe verbunden habe – gelegentlich nachts entfernt, verstehen Sie, und am nächsten Morgen wieder aufgetragen. Eine bloße Vermutung, werden Sie sagen, und eher falsch als richtig. Ich bestreite das nicht; ich sage nur, dass meine Vermutung mich ermutigte, ein oder zwei Nachforschungen anzustellen. Es ist unnötig, Sir, Sie mit den Schwierigkeiten, auf die ich dabei stieß, zu behelligen. Lassen Sie mich nur sagen, dass ich es verstand, sie zu überwinden. In der letzten Nacht, als der alte Parley wohlbehalten im Bett war, drangen seine Frau, sein Dienstmädchen und ich in das Heiligtum von Miss Beaumonts Zimmer ein. Wir hatten keineswegs Angst, die Dame zu wecken, da wir (beim Abendessen) die Vorkehrung getroffen hatten, ihr – sagen wir den Segen einer guten Nachtruhe – zu verschaffen. Sie war scheinbar ein wenig nervös und ruhelos gewesen, bevor sie zu Bett ging. Jedenfalls war ihre Perücke auf den Fußboden geworfen worden. Wir gingen daran vorbei und gingen zum Bett. Sie lag auf ihrem Rücken; ihr Mund war offen und ihre Arme hingen auf jeder Seite herunter. Ihr eigenes hübsches, blondes Haar war nicht sehr lang; und ihre falsche Farbe (sie war, Sir, als eine dunkle Dame in der Öffentlichkeit verkleidet) war in dieser Nacht auf ihrem Gesicht, ihrem Nacken und ihren Händen verblieben. So weit hatten wir nur entdeckt, dass sie war, was Mrs. Parley in ihr vermutete – eine unbekannte Betrügerin. Es blieb mir übrig, herauszufinden, wer die Frau wirklich war. Die Befestigung ihres Nachtkleides um die Kehle herum hatte sich gelöst. Ihr Busen war entblößt. Bei meiner Seele! Mir graute es, als die Wahrheit über mich hereinbrach! Da war es, Sir, ohne Zweifel – dort, auf der rechten Seite, unter der rechten Brust -«
Ich sprang von meinem Stuhl auf. Auf meinem Schreibtisch lag ein Flugblatt, welches ich gelesen und wieder gelesen hatte, bis ich es auswendig konnte. Es war von den Londoner Behörden im ganzen Vereinigten Königreich verteilt worden; und es enthielt die Beschreibung einer Frau, die eines schrecklichen Verbrechens verdächtig war, und die sich der Verfolgung durch die Polizei entzogen hatte. Ich schaute auf das Flugblatt; ich schaute auf den Mann, der mit mir sprach.
»Großer Gott!« schrie ich. »Haben Sie die Narbe gesehen?«
»Ich sah sie, Landvogt, so deutlich wie ich Sie sehe.«
»Und den falschen Eckzahn auf der linken Seite ihres Mundes?«
»Ja, Sir – und das Gold daran, das für sich spricht.«
Jahre sind vergangen, seit dieses Gespräch, auf das ich mich gerade bezog, geführt wurde. Aber einige Personen werden sich an einen berühmten Kriminalfall in London erinnern – und würden, wenn ich mich unbenommen fühlen würde, ihn zu erwähnen, den Namen der grausamsten Mörderin der Moderne wiedererkennen.

VI
Der Haftbefehl für die Frau wurde ausgestellt. Sachkundige Zeugen identifizierten sie und die Voruntersuchungen des Gesetzes nahmen ihren Lauf.
Für mich war der ernste Teil der Entdeckung der Teil, welcher einen Verdacht auf den unglücklichen Benjamin Parley warf. Der Schein war unbestreitbar gegen ihn. Er wurde nicht nur verdächtigt; er wurde sogar der Beihilfe zur Flucht der Mörderin von der Justiz angeklagt. Bei dem Ärger, der ihm zuteil wurde, konnte ich mich nützlich machen, indem ich Parley beistand und seine unglückliche Familie beruhigte.
Man wird die Behauptung kaum glauben, aber ich erkläre, es ist wahr, dass die Verblendung des Mannes von ihm stärker als je Besitz ergriff. Seine eigenen Interessen waren in keiner Weise von Wichtigkeit für ihn; er schien sogar nur wenig betroffen von dem Leid seiner Frau und seiner Familie zu sein; Seine einzige überwältigende Sorge war die um die Gefangene. »Ich glaube an ihre Unschuld«, sagte er tatsächlich zu mir, »wie ich an meine Religion glaube. Sie ist fälschlich dieses schrecklichen Verbrechens angeklagt, Sir.« Er war unfähig, sich über die grausame Täuschung, die sie auf ihn angewandt hatte, zu ärgern oder selbst sie einzusehen. In einem Wort, er war hingebungsvoller in sie verliebt denn je.
Und wohlgemerkt, er war hierbei keineswegs wahnsinnig! Ich kann es aus eigener Erfahrung beantworten; er war im Vollbesitz seiner Kräfte.
Es kam der Befehl, dass die Frau nach London weggebracht werden sollte, um vor das Oberste Strafgericht gestellt zu werden. Parley hatte davon gehört. In den ergreifendsten Worten flehte er mich an, ihn freizustellen und ihn mit der Pflicht, die Führung der Gefangenen zu übernehmen, zu betrauen!
Es war meine Angelegenheit, sie im Eisenbahnwaggon unter ordentliche Aufsicht zu stellen. Der Zug fuhr am Morgen ab. Sie weigerte sich, ihr Bett zu verlassen. Selbstverständlich wurde ich in diesem Notfall gerufen.
Die Mörderin war keine wunderschöne Frau; sie war nicht einmal eine hübsche Frau. Aber sie hatte ein sinnliches Lächeln, eine einzigartige musikalische Stimme, eine feine Figur und ein sehr großes Selbstvertrauen. In dem Augenblick, als ich das Zimmer betrat, erprobte die schreckliche Kreatur ihre Mächte der Faszination am Landvogt – sie nahm die Miene eines unschuldigen Opfers an, welches von Leiden an Körper und Geist überwältigt war. Ich sah auf meine Uhr und sagte ihr, dass sie keine Zeit zu verlieren hätte. Nicht im mindesten beunruhigt, wechselte sie zu einer anderen Miene; sie zog mich unbekümmert und zynisch in ihr Vertrauen. »Mein lieber Sir, Sie hätten mich nie geschnappt«, sagte sie, »wenn ich nicht einen Fehler gemacht hätte. Als Gouvernante in der Familie eines Ex-Polizeibeamten wäre ich vor Entdeckung sicher gewesen, wenn ich nicht wie selbstverständlich angenommen hätte, dass ich Parleys alte Frau um meinen kleinen Finger wickeln könnte wie den Rest von ihnen. Wer hätte gedacht, dass sie auf einen hässlichen, alten Mann in ihrem Alter eifersüchtig sein konnte? Hätten Sie sich nicht selbst gesagt: »All diese Dinge müssen lange vorbei sein, wenn eine Frau sechzig Jahre oder älter ist?« Kann es Eifersucht ohne Liebe geben? Und lieben wir, wenn wir abscheuliche, schwabbelige Wesen sind, die mit Runzeln überdeckt sind? Oh, Pfui! Pfui!«
Ich nahm meine Taschenuhr wieder heraus.
»Wenn ich in zehn Minuten nicht höre, dass Sie aufgestanden und angekleidet sind«, sagte ich, »werde ich sie in eine Decke einwickeln lassen und von einer Polizeitruppe zum Zug bringen lassen.«
Mit dieser Warnung verließ ich den Raum. Die Frau, die sie bewachte, erzählte mir später, dass ihre Redeweise zu schrecklich war, um sie zu wiederholen. Aber sie war klug genug, um schnell einzusehen, dass ich es ernst meinte und sie war rechtzeitig aufgestanden und angezogen für den Zug.

VII
Wenn ich erzähle, dass Parley einer der Zeugen war, die bei dem Prozess befragt wurden, wird man verstehen, dass man ihn von der ernsten Anklage entlastet hatte, ein (in rechtlichen Worten) 'Begünstiger' gewesen zu sein. Er ging so fest von ihrer Unschuld überzeugt wie je nach London. Sie wurde aufgrund unbestreitbarer Beweise für schuldig befunden und zum Tode verurteilt.
Beim Ende des Prozesses war Parley nicht zu seiner Familie zurückgekehrt; er hatte nicht einmal geschrieben. Seine Frau folgte ihm nach London. Er schien sie kaum wiederzuerkennen.
Der eine Gedanke, der Besitz von ihm ergriffen hatte, war der hoffnungslose Gedanke, eine Begnadigung zu erreichen. Er war gegen jeden anderen weltlichen Gesichtspunkt vollkommen gleichgültig. Unkundige Leute hielten ihn für verrückt. Er schrieb an die Zeitungen; er suchte die Regierungsbüros heim; er erkämpfte sich seinen Weg in das Haus des Richters, der dem Prozess vorgesessen hatte. Ein bedeutender Arzt wurde um Rat gefragt. Nach sorgfältiger Untersuchung verkündete er, dass der Patient vollkommen gesund sei.
Durch den Einfluss von Freunden, die mit den städtischen Behörden vertraut waren, wurde dem armen Kerl Zugang zum Gefängnis verschafft, während die Verbrecherin auf die Hinrichtung wartete. Seine Frau hörte, was während dem Gespräch geschah; aber sie war unfähig, es zu wiederholen; mir oder sonst jemand gegenüber. Derselbe unglückselige Schrei entfuhr ihr immer, wenn sie auf dieses Thema angesprochen wurde. »Oh, fragen Sie mich nicht! Fragen Sie mich nicht!«
Am Abend vor der Hinrichtung brach er in einen Anfall hysterischer Schreie aus. Diesem Ausbruch gewaltiger Emotionen folgte ein kataleptischer Anfall. Mehr als achtundvierzig Stunden vergingen, bis er wieder zu Bewusstsein kam. Man fürchtete, er würde seinen Verstand verlieren, als er die Fähigkeit, zu fühlen und zu leiden, wiedererlangt hatte. Seine Genesung hatte kein solches Ergebnis zur Folge.
Am selben Tag sprach er von ihr mit anderen zum ersten und letzten Mal. Er sagte, sehr leise, mit einer bemerkenswerten Ruhe in seinem Gesicht: »Ist sie tot?« Sie antworteten: »Ja.« Er sagte nichts mehr.
Am nächsten Morgen fragte seine Frau, ob er mit ihr wieder nach Schottland zurückgehen könne. Er war durchaus bereit, alles zu tun, was sie wünschte. Zwei oder drei Tage nach ihrer Rückkehr sah ich ihn. Sein graues Haar war vollkommen weiß geworden; Sein Auftreten war gedrückt; sein Gesicht, voll von lebhaftem Ausdruck in vergangenen Tagen, schien in einen Zustand von unveränderlicher Starre gefallen zu sein. Das war alles.
Nach einer Weile fragte ich seine Frau und seine Kinder, ob sie irgendeine Veränderung zum Schlechteren an ihm bemerkt hatten. Außer dass er sehr still war, bemerkten sie keine Veränderung zum Schlechteren. Er war einmal wieder der gute Ehemann und liebe Vater ihrer vergangenen glücklichen Tage. Sprach er je von der Frau? Niemals.
Ich war nicht ganz befriedigt. Einen Monat später fragte mich Mrs. Parley, ob ich dächte, ein Freund von mir, der einer unserer größten lebenden Ärzte war, könne Benjamin helfen. Ich fragte, was mit ihm los sei. »Er scheint schwächer zu werden«, war die bloße Antwort.
Am selben Tag nahm ich meinen Freund mit zu Parleys Haus. Nachdem er mit dem Patient gesprochen und einige Fragen gestellt hatte, bat er um die Erlaubnis, eine vollständige Untersuchung durchzuführen. Die beiden zogen sich zurück. Als sie zurückkamen, war Mrs. Parley natürlich ein wenig beunruhigt. »Ist da irgendetwas, was nicht in Ordnung ist, Sir?« fragte sie. Und zu meinem Erstaunen antwortete der Doktor: »Nichts, was ich feststellen kann.«
Als wir das Haus verlassen hatten, stellte ich ihm die Frage: »Was bedeutet das?«
»Es bedeutet«, antwortete er, »dass der alte Mann im Sterben liegt; und ich kann nicht feststellen, warum.«
Einmal pro Woche besuchte der große Arzt Parley, wobei er sich immer weigerte, ein Honorar zu nehmen; aber ab und zu fragte er um Erlaubnis, einen befreundeten Arzt mitbringen zu dürfen. Eines Tages besuchte er mich und sagte: »Wenn du zu dem alten Polizeioffizier Lebwohl sagen willst, hast du keine Zeit zu verlieren.« Ich ging am selben Tag zu dem Haus. Parley schlief gerade. Einige Stunden später kehrte ich zurück. Parley war tot. Ich fragte, woran er gestorben war und der Doktor sagte: »Wir haben die Erlaubnis der Witwe, eine Obduktion durchzuführen. Warte ein wenig.«
Ich wartete, bis das Begräbnis vorbei war und kehrte dann auf das Thema zurück.
»Welche Entdeckungen habt ihr bei der Obduktion gemacht?«
»Wir haben keine Entdeckungen gemacht.«
»Aber es muss doch einen Grund für seinen Tod gegeben haben?«
»Ich nannte es auf dem Totenschein Altersschwäche«, antwortete mein Freund. »Ein bloßer Vorwand! Die Verfassung des Mannes war einwandfrei; und er war noch nicht einmal siebzig Jahre alt. Ein Leichenbeschauer hat nichts mit Gefühlsfragen zu schaffen. Ein Doktor ist fest dazu verpflichtet, sich in seinem Attest an Tatsachen zu halten, andererseits -«
Er stockte und zog mich außerhalb der Hörweite der Trauernden, die auf dem Friedhof verweilten.
»Erwähne es nicht bei meinen Kollegen«, sagte er. »Wenn es wirklich so etwas gibt – Benjamin Parley ist an gebrochenem Herzen gestorben.«

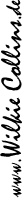
 Startseite
Startseite
 Neuigkeiten
Neuigkeiten Inhaltsverzeichnis aktuelle
Übersetzung
Inhaltsverzeichnis aktuelle
Übersetzung