
Anmerkungen
Die kuriose Legende, die mit der Geburt dieses »Adoptivsohns« verbunden ist, und die Fakten, die sich auf seine außergewöhnliche Karriere im Nachleben beziehen, sind den »Aufzeichnungen« der französischen Polizei aus dieser Zeit entnommen. In diesem Fall, und in den Fällen der anderen Papiere in der vorliegenden Sammlung, die sich mit fremden Vorfällen und Charakteren befassen, während die Fakten jeder Erzählung in gedruckter Form existieren, ist die Form, in der die Erzählung gegossen ist, von mir selbst ausgedacht. Wären diese Tatsachen dem allgemeinen Leser ohne weiteres zugänglich gewesen, so wären die betreffenden Abhandlungen nicht nachgedruckt worden. Aber die seltenen und neugierigen Bücher, aus denen meine abgeleitet sind, sind seit langem vergriffen und werden aller Wahrscheinlichkeit nach nie wieder veröffentlicht werden.

I.
Die Ereignisse, die seiner Geburt vorausgingen.
Zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts stand auf einem Felsen im Meer, in der Nähe eines Fischerdorfes an der bretonischen Küste, eine Turmruine mit einem sehr schlechten Ruf. Seit Menschengedenken war kein Sterblicher bekannt, der ihn bewohnt hätte. Der einzige Pächter, den die Überlieferung mit der Besetzung des Ortes zu einer fernen Zeit in Verbindung brachte, war aus den höllischen Gefilden eingezogen, von denen niemand wusste, warum — hatte darin gelebt, niemand wusste, wie lange — und hatte den Besitz verlassen, ohne zu wissen wann. Unter solchen Umständen, war nichts natürlicher, als daß dieses unirdische Individuum seinem Wohnsitz einen Namen gab. Aus diesem Grund war das Gebäude fortan in der ganzen Nachbarschaft als Satansturm bekannt.
Anfang des Jahres siebzehnhundert wurden die Bewohner des Dorfes eines Nachts aufgeschreckt, als sie einen roten Feuerschein im Turm sahen und in der gleichen Richtung einen übernatürlich starken Geruch von gebratenem Fisch wahrnahmen. Am nächsten Morgen stellten die Fischer, die mit ihren Booten an dem Gebäude vorbeifuhren, erstaunt fest, dass sich ein Fremder darin niedergelassen hatte. Aus der Ferne betrachtet, schien er ein feiner, großer, stämmiger Kerl zu sein.
Er trug Fischerkleidung und hatte ein eigenes neues Boot, das in einer Felsspalte bequem vertäut war. Hätte er einen Ort mit anständigem Ruf bewohnt, hätten seine Nachbarn sofort seine Bekanntschaft gemacht; aber so, wie die Dinge lagen, war alles, was sie wagen konnten, ihn schweigend zu beobachten.
Der erste Tag verging, und obwohl es schönes Wetter war, machte er keinen Gebrauch von seinem Boot. Es folgte der zweite Tag, an dem das schöne Wetter anhielt, und er war immer noch so untätig wie zuvor. Am dritten Tag, als ein heftiger Sturm alle Boote des Dorfes am Strand festhielt, — am dritten Tag, inmitten des Sturms, fuhr der Mann vom Turm los, um seinen ersten Fischereiversuch in fremden Gewässern zu machen! In einer Sturmflaute kamen er und sein Boot wohlbehalten zurück, und die Dorfbewohner, die oben auf der Klippe zuschauten, sahen, wie er die Fische körbeweise zu seinem Turm hinauftrug. Eine solche Beute war niemals das Los eines von ihnen, und der Fremde hatte sie in einem wilden Windsturm genommen.
Daraufhin beriefen die Bewohner des Dorfes einen Rat ein. Die Führung in der Debatte übernahm ein kluger junger Bursche, ein Fischer, namens Poulailler, der standhaft erklärte, dass der Fremde im Turm höllischen Ursprungs sei. »Ihr anderen könnt ihn nennen, wie ihr wollt«, sagte Poulailler, »ich nenne ihn den Teufelsfischer!«
Die so geäußerte Meinung erwies sich als die Meinung aller Anwesenden— mit der einzigen Ausnahme des Dorfpfarrers. Der Pfarrer sagte: »Vorsichtig, meine Söhne, verurteilt nicht voreilig vor Sonntag den Mann vom Turm. Wartet ab, ob er in die Kirche kommt.«
»Und wenn er nicht in die Kirche kommt?«, fragten alle Fischer in einem Atemzug.
»In diesem Fall«, antwortete der Priester, »werde ich ihn exkommunizieren; und dann, meine Kinder, könnt ihr ihn nennen, wie ihr wollt.«
Der Sonntag kam, und kein Zeichen des Fremden verdunkelte die Kirchentüren. Er wurde daraufhin exkommuniziert. Das ganze Dorf machte sich sofort Poulaillers Idee zu eigen und nannte den Mann vom Turm bei dem Namen, den Poulailler ihm gegeben hatte: »Der Teufelsfischer«.
Diese heftigen Maßnahmen zeigten nicht die geringste Wirkung auf die teuflische Person, der sie veranlasst hatte. Er blieb weiterhin untätig, wenn das Wetter schön war, fuhr zum Fischen hinaus, wenn kein anderes Boot im Ort es wagte, in See zu stechen, und kehrte mit vollen Netzen, unbeschädigtem Boot und gesund und munter in seine einsame Behausung zurück. Er machte keinen Versuch, von irgendjemandem zu kaufen oder zu verkaufen, er hielt sich ständig vom Dorf fern, er lebte von seinen eigenen, übernatürlich stark gebratenen Fischen, und er sprach nie mit einer lebenden Seele, mit der einzigen Ausnahme von Poulailler selbst. Eines schönen Abends, als der junge Mann am Turm vorbei nach Hause ruderte, stürzte der Teufelsfischer auf den Felsen hinaus, sagte: »Danke, Poulailler, dass du mir einen Namen gegeben hast«, verbeugte sich höflich und stürzte wieder hinein. Der junge Fischer spürte, wie ihm die Worte kalt den Rücken hinunterliefen, und wann immer er wieder auf See war, machte er von diesem Tag an einen großen Bogen um den Turm.
Die Zeit verging, und ein wichtiges Ereignis erfüllte Poulaillers Leben. Er war verlobt und wollte heiraten. An dem Tag, an dem seine Verlobung öffentlich bekannt gegeben wurde, scharten sich seine Freunde auf dem Fischersteg des Dorfes lautstark um ihn, um ihre Glückwünsche auszusprechen. Während sie alle in vollem Geschrei waren, ertönte plötzlich eine seltsame Stimme im Durcheinander, der alle im Nu verstummen ließ. Die Menge wich zurück und entdeckte den Teufelsfischer, der den Steg hinaufschlenderte. Es war das erste Mal, dass er einen Fuß — einen gespaltenen Fuß — in den Bereich des Dorfes gesetzt hatte.
Meine Herren«, sagte der Teufelsfischer, »wo ist mein Freund Poulailler?« Er stellte die Frage mit vollkommener Höflichkeit; er sah in seiner Fischertracht bemerkenswert gut aus; er verströmte einen angenehmen Geruch von gebratenem Fisch; er hatte ein herzliches Nicken für die Männer und ein süßes Lächeln für die Frauen; aber bei all diesen persönlichen Vorzügen wichen alle vor ihm zurück, und niemand beantwortete seine Frage. Die Kälte des Empfangs durch das Volk beschämte ihn jedoch in keiner Weise. Er sah sich mit suchenden Augen nach Poulailler um, entdeckte den Ort, an dem er stand, und sprach ihn auf die freundlichste Weise an.
»Du willst also heiraten?«, bemerkte der Teufelsfischer.
»Was geht dich das an?«, sagte Poulailler. Er war innerlich erschrocken, aber äußerlich unwirsch — eine nicht ungewöhnliche Kombination von Umständen bei Männern seiner Klasse und in seiner mentalen Verfassung.
Mein Freund«, fuhr der Teufelsfischer fort, »ich habe Ihre höfliche Aufmerksamkeit nicht vergessen, als Sie mir einen Namen gaben, und ich komme hierher, um sie zu vergelten. Du wirst eine Familie haben, Poulailler, und dein erstes Kind wird ein Junge sein. Ich schlage vor, diesen Jungen zu meinem Adoptivsohn zu machen.«
Es fuhr Poulailler eiskalt durchs Mark; aber er wurde trotz dieses Zustandes ruppiger denn je.
»Sie werden nichts dergleichen tun«, antwortete er. »Selbst wenn ich die größte Familie in Frankreich habe, wird kein Kind von mir jemals in Ihre Nähe kommen.«
»Dafür werde ich Ihren Erstgeborenen adoptieren«, beharrte der Teufelsfischer. »Poulailler, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Meine Damen und Herren, das selbe Ihnen allen auch.«
Mit diesen Worten zog er sich von dem Treffen zurĂĽck, und das Mark in Poulaillers RĂĽcken begann seine Temperatur zurĂĽckzugewinnen.
Der nächste Morgen war stürmisch, und das ganze Dorf erwartete, das Boot vom Turm aus, wie üblich, auf das Meer hinausfahren zu sehen. Es war nicht zu sehen. Später am Tag wurde der Felsen, auf dem das Gebäude stand, aus der Ferne untersucht. Weder Boot noch Netze befanden sich an ihren üblichen Plätzen. In der Nacht wurde der rote Schimmer des Feuers zum ersten Mal vermisst. Der Teufelsfischer war fort! Er hatte seine Absichten auf dem Steg verkündet und war verschwunden. Was hatte das zu bedeuten? Niemand wusste es.
An Poulaillers Hochzeitstag rief ein unheilvoller Umstand die Erinnerung an den teuflischen Fremden wieder wach und brachte den Rücken des Bräutigams in arge Bedrängnis. In dem Augenblick, als die Trauung vollzogen war, stahl sich ein genüsslicher Duft von gebratenem Fisch in die Nasen der Gesellschaft, und eine Stimme von unsichtbaren Lippen sagte: »Bleib’ bei guter Laune, Poulailler; Ich habe mein Versprechen nicht vergessen!«
Ein Jahr später befand sich Madame Poulailler in den Händen der Hebamme des Bezirks, und es kam zu einer Wiederholung des unheilvollen Umstandes. Poulailler wartete in der Küche, um zu hören, wie es oben weiterging. Die Krankenschwester kam mit einem Baby herein. »Was ist es?«, fragte der glückliche Vater, »Mädchen oder Junge?«
Bevor die Schwester antworten konnte, erfüllte ein Geruch von übernatürlich gebratenem Fisch die Küche, und eine Stimme aus unsichtbaren Lippen antwortete: »Ein Junge, Poulailler, und ich habe ihn!«
Das waren die Umstände, unter denen der Gegenstand dieser Memoiren in die Freuden und Leiden des irdischen Daseins eingeführt wurde.

II.
Seine Kindheit und sein frĂĽhes Leben.
Wenn ein Junge unter Vorzeichen geboren wird, die seine Eltern zu der Annahme verleiten, dass, während der körperliche Teil von ihm zu Hause sicher ist, der geistige Teil anderswo einem höllischen Befehl unterworfen wird, was sollen sein Vater und seine Mutter mit ihm tun? Sie müssen das Beste tun, was sie können, — was genau das war, was Poulailler und seine Frau mit dem Helden dieser Seiten tat.
In erster Linie ließen sie ihn sofort taufen. Man beobachtete mit Entsetzen, dass sein Kindergesicht von Fratzen verzerrt war und dass seine Kinderstimme mit einem übernatürlich lustvollen Ton brüllte, sobald der Priester ihn berührte. Das erste, was er verlangte, als er sprechenkonnte, war »gebratener Fisch«; und der erste Ort, zu dem er gehen wollte, als er laufen lernte, war der teuflische Turm auf dem Felsen. »Er wird nichts lernen«, sagte der Lehrer, als er alt genug war, um zur Schule zu gehen. »Verprügelt ihn«, sagte Poulailler, und der Lehrer prüglete ihn. »Er wird nicht zur Erstkommunion kommen«, sagte der Pfarrer. » Verprügeln Sie ihn «, sagte Poulailler; und der Priester verpügelte ihn. Die Obstgärten der Bauern wurden beraubt; die benachbarten Kaninchenställe wurden entvölkert; Wäsche wurde aus den Gärten gestohlen, und Netze wurden am Strand zerrissen. »Der Teufel soll Poulaillers Jungen holen«, war der allgemeine Ausruf. »Der Teufel hat ihn erwischt«, war Poulaillers Antwort. »Und doch ist er ein hübscher Junge«, sagte Madame Poulailler. Und das war er auch — so groß, so stark, so gut aussehend, wie man ihn in ganz Frankreich sehen konnte. »Lasst uns für ihn beten«, sagte Madame Poulailler. »Lasst uns ihn auspeitschen«, sagte ihr Mann. »Unser Sohn ist geprügelt worden, bis alle Stöcke in der Nachbarschaft zerbrochen sind«, flehte seine Mutter. »Wir werden ihn als nächstes mit dem Tauende versuchen«, erwiderte der Vater, »er wird zur See fahren und in einer Atmosphäre der Prügel leben. Unser Sohn soll ein Schiffsjunge werden.« Für Poulailler Junior war es ein Klacks; er wusste, wer ihn adoptiert hatte, ebenso wie sein Vater; er war sich von klein auf instinktiv des Interesses des Teufelsfischers an seinem Wohlergehen bewusst gewesen; er kümmerte sich um keine irdische Disziplin; und ein Schiffsjunge wurde er mit zehn Jahren.
Nach zwei Jahren der (ziemlich wirkungslos angewandten) Knechtschaft raubte der Gegenstand dieser Memoiren seinen Kapitän aus und floh in einem englischen Hafen. London wurde der nächste Schauplatz seiner Abenteuer. Im Alter von zwölf Jahren überzeugte er die Gesellschaft in der Metropole, dass er der verlassene natürliche Sohn eines französischen Herzogs sei. Nachdem die britische Gutmütigkeit vier Jahre lang blind für ihn gesorgt hatte, öffnete sie die Augen und fanden alles im Alter von sechzehn Jahren heraus. Daraufhin kehrte er nach Frankreich zurück und trat als Trommler in die Armee ein. Mit achtzehn desertierte er und zog mit den Zigeunern. Er wahrsagte, zauberte, tanzte auf dem Drahtseil, Schauspielerte, verkaufte Quacksalber-Medizin, änderte seine Meinung wieder und kehrte zur Armee zurück. Hier verliebte er sich in die Vivandiére [normalerweise eine Frau, die den Truppen folgte, um den Soldaten Essen und Trinken zu verkaufen] seines neuen Regiments. Der Feldwebel der Kompanie, der die gleiche zärtliche Schwäche hatte, nahm ihm die Aufmerksamkeiten für die Dame natürlich übel. Poulailler behauptete sich (vielleicht ungerechtfertigt), indem er seinem Offizier auf die Ohren gab. Die Schwerter blitzten auf beiden Seiten auf, und Poulaillers Klinge ging durch das zarte Herz des Feldwebels. Die Grenze war zum Greifen nah. Poulailler wischte seinen Degen ab und überquerte sie.
Das Todesurteil gegen ihn wurde in seiner Abwesenheit gesprochen. Wenn die Gesellschaft uns zum Tode verurteilt hat, wie sollen wir dann, wenn wir Menschen mit einem gewissen Geist sind, das Kompliment erwidern? Indem wir die Gesellschaft dazu verdammen, uns am Leben zu erhalten — oder, mit anderen Worten, indem wir rechts und links für unseren Lebensunterhalt rauben. Poulaillers Schicksal war nun vollendet. Er war dazu auserkoren, der größte Dieb seiner Zeit zu werden; und als das Schicksal ihn an seinen Platz in der Welt rief, trat er vor und nahm ihn ein. Sein bisheriges Leben war nur das eines jungen Gauners gewesen; nun sollte er dem teuflischen Vater, der ihn adoptiert hatte, gerecht werden und zu einem ausgewachsenen Räuber heranwachsen.
* *
*
Seine ersten Abenteuer wurden in Deutschland vollbracht. Sie zeigten eine so neuartige Kombination, so kühn, so geschickt und selbst in seinen mörderischsten Momenten so unwiderstehliche Fröhlichkeit und gute Laune, dass sich in kürzester Zeit eine Schar von Gleichgesinnten um ihn scharte. Als „Oberbefehlshaber der Diebesarmee“ schwankte seine Popularität nie. Er hatte drei Schwächen — und welcher berühmte Mann wäre ohne sie? Erste Schwäche: Er war übermäßig empfänglich für die Reize des schönen Geschlechts. Zweite Schwäche: Er hatte eine gefährliche Vorliebe für Streiche. Dritte Schwäche (geerbt von seinen Adoptivvater): Sein unersättlicher Appetit für gebratenen Fisch. Was die Vorzüge anbelangt, die diesen Mängeln entgegenzusetzen sind, so sind einige bereits vermerkt worden, — und andere werden gleich erscheinen. An dieser Stelle sei nur vorausgeschickt, dass er einer der schönsten Männer seiner Zeit war, dass er sich prächtig kleidete und dass er zu den erhabensten Taten der Großzügigkeit fähig war, wo immer es sich um eine schöne Frau handelte; das zunächst einmal zum Verständnis; lassen Sie uns nun in die Erzählung seines letzten Abenteuers in Deutschland eintreten, bevor er nach Frankreich zurückkehrte. Dieses Abenteuer ist etwas mehr als ein bloßes Beispiel für seine Geschick es erwies sich später als das verhängnisvolle Ereignis in seinem Leben.
An einem Montag hatte er auf der Landstraße angehalten und einen Adligen aus Italien, den Marquis Petrucci aus Siena, seiner Wertsachen und Papiere beraubt. Am Dienstag war er zu einem weiteren Schlag bereit. Auf der Höhe eines steilen Hügels postiert, überwachte er die Straße, die sich auf der einen Seite zum Gipfel hinaufschlängelte, während sich seine Verfolger auf der Straße, die auf der anderen Seite hinunterführte, verschanzten. Die erwartete Beute war in diesem Fall die Kutsche (mit einer großen Geldsumme) des Barons De Kirbergen.
Bald sah Poulailler die Kutsche in der Ferne am Fuße des Hügels, und vor ihr, zwei Damen zu Fuß die Anhöhe erklimmend. Es waren die Töchter des Barons — Wilhelmina, eine blonde Schönheit; Frederica, eine Brünette — beide reizend, beide kultiviert, beide zierlich, beide jung. Poulailler schlenderte den Hügel hinunter, um die bezaubernden Reisenden zu treffen. Er sah, verbeugte sich, stellte sich vor und verliebte sich auf der Stelle in Wilhelmina. Die beiden bezaubernden jungen Frauen gaben auf die argloseste Weise zu, dass das Eingeschlossensein in der Kutsche sie ungeduldig gemacht hatte und dass sie den Hügel hinaufgingen, um als Heilmittel die sanfte Bewegung zu versuchen. Poulaillers Herz war gerührt, und Poulaillers Großzügigkeit gegenüber dem anderen Geschlecht wurde sofort geweckt. Mit einer höflichen Entschuldigung an die jungen Damen rannte er auf einer Abkürzung zurück zu dem Hinterhalt auf der anderen Seite des Hügels, wo seine Männer postiert waren.
»Meine Herren!« rief der großzügige Dieb, »im reizenden Namen von Wilhelmina de Kirbergen, fordere ich Sie alle auf, die Kutsche des Barons frei passieren zu lassen.« Die Bande war dafür nicht empfänglich; die Bande widersetzte sich. Poulailler kannte sie. Er hatte vergeblich an ihr Herz appelliert; jetzt appellierte er an ihre Taschen. »Meine Herren!«, fuhr er fort, »entschuldigen Sie mein momentanes Missverständnis Ihrer Empfindungen. Hier ist mein halber Anteil am Besitz des Marquis Petrucci. Wenn ich ihn unter euch aufteile, lasst ihr dann die Kutsche frei fahren?« Die Bande kannte den Wert des Geldes und akzeptierte die Bedingungen. Poulailler eilte den Hügel hinauf und kam gerade rechtzeitig oben an, um die jungen Damen in die Kutsche zu helfen.» Charmanter Herr!« sagte die weiße Whilhelmina zur braunen Frederica, als sie davonfuhren. Unschuldige Seele! was hätte sie gesagt, wenn sie gewusst hätte, dass ihre körperlichen Reize das Eigentum ihres Vaters gerettet hatten? Sollte sie den charmanten Herrn jemals wiedersehen? Ja; sie sollte ihn am nächsten Tag wiedersehen — und mehr noch, das Schicksal sollte sie fortan fest mit dem Leben des Räubers und dessen Untergang verbinden.
Poulailler vertraute die Leitung der Bande seinem Oberleutnant an, folgte der Kutsche zu Pferd und ermittelte den Aufenthaltsort des Barons in dieser Nacht.
Am nächsten Morgen klopfte ein prächtig gekleideter Fremder an die Tür. »Wie heißen Sie, mein Herr?«, fragte der Diener. »Der Marquis Petrucci, von Siena«, antwortete Poulailler. »Wie geht es den jungen Damen nach ihrer Reise?« Der Marquis wurde hereingeführt und dem Baron vorgestellt. Der Baron war natürlich hocherfreut, einen adeligen Bruder zu empfangen; Fräulein Wilhelmina war bescheiden glücklich, den charmanten Mann wiederzusehen; Fräulein Frederica freute sich liebevoll im Namen ihrer Schwester. Da Poulailler nicht geneigt war, Zeit zu verlieren, wenn es um seine Zuneigung ging, drückte er an diesem Abend seine Gefühle gegenüber dem geliebten Objekt aus. Am nächsten Morgen hatte er ein Gespräch mit dem Baron, bei dem er die Papiere vorlegte, die ihn als den Marquis auswiesen. Nichts könnte für das Gemüt der besorgtesten Eltern befriedigender sein — die beiden Adligen umarmten sich. Sie lagen sich noch in den Armen, als ein zweiter Fremder an die Tür klopfte. »Welcher Name, Sir?«, sagte der Diener. Der Marquis Petrucci, von Siena«, antwortete der Fremde. »Unmöglich!« sagte der Diener; »seine Lordschaft ist jetzt im Haus.« — »Führen Sie mich herein, Halunke!« rief der Besucher. Der Diener fügte sich, und die beiden Marquisen standen sich gegenüber. Poulaillers Gelassenheit war nicht im Geringsten erschüttert; er war zuerst ins Haus gekommen, und er hatte die Papiere vorzuweisen. »Du bist der Schurke, der mich beraubt hat!« schrie der wahre Petrucci. »Du bist betrunken, verrückt oder ein Hochstapler«, erwiderte der falsche Petrucci. »Schickt nach Florenz, wo man mich kennt!«, rief einer der Marquisen, indem er sich dem Baron energisch zuwandte. »Schicken Sie unbedingt nach Florenz«, echote der andere und wandte sich ebenfalls an den Baron. »Meine Herren«, erwiderte der edle Kirbergen, »ich will mir die Ehre geben, Ihren Rat zu befolgen« — und er schickte dementsprechend nach Florenz.
Bevor der Bote auf seiner Reise zehn Meilen vorangeschritten war, hatte Poulailler zwei Worte unter vier Augen zu der empfänglichen Wilhelmina gesagt, und das Paar brannte noch am selben Abend aus der fürstlichen Residenz durch. Noch einmal überquerte der Gegenstand dieser Memoiren die Grenze und betrat erneut Frankreich. Gleichgültig gegenüber den Reizen des Landlebens, ließ er sich sofort mit der geliebten Wilhelmina in Paris nieder. In dieser schönen Stadt erlebte er seine seltsamsten Abenteuer, vollbrachte seine kühnsten Taten, beging seine gewaltigsten Raubüberfälle und wurde, mit einem Wort, sich selbst und seinem höllischen Gönner in der Rolle des Adoptivsohns des Teufelsfischers voll gerecht.

III.
Seine Karriere in Paris.
Einmal in der französischen Metropole etabliert, plante und führte Poulailler jenes ausgedehnte System von fortwährenden Raubüberfällen — und gelegentlichen Morden — aus, das ihn zum Schrecken und Erstaunen von ganz Paris machte. Sowohl drinnen als auch draußen war ihm das Glück hold. Keine häuslichen Sorgen bedrängten seinen Geist und lenkten ihn von der Verfolgung seiner hervorragenden öffentlichen Karriere ab. Die Anhänglichkeit des reizenden Geschöpfes, mit dem er aus Deutschland durchgebrannt war, überlebte die Entdeckung, dass der Marquis Petrucci der Räuber Poulailler war. Dem Mann ihrer Wahl treu ergeben, teilte die ergebene Wilhelmina sein Schicksal und führte sein Haus. Und warum auch nicht, wenn sie ihn liebte — im Namen des alles erobernden Cupid, warum nicht?
Zusammen mit ausgewählten Männern aus seiner deutschen Gefolgschaft und neuen Rekruten, die er in Paris gesammelt hatte, entblößte Poulailler nun die Gesellschaft und ihre Sicherheitsvorkehrungen. Cartouche selbst stand ihm an Kühnheit und Gerissenheit in nichts nach. Im Laufe der Zeit wurde die ganze Stadt durch den neuen Räuber und seine Bande in Panik versetzt — selbst die Boulevards waren nach Einbruch der Dunkelheit menschenleer. Monsieur Hérault, der damalige Polizeileutnant, der verzweifelt Poulailler auf anderem Wege zu fassen, setzte schließlich eine Belohnung von hundert Goldmünzen und eine Stelle in seinem Büro im Wert von zweitausend Livres pro Jahr für denjenigen aus, der den Räuber lebend fassen würde. Die Plakate wurden in ganz Paris ausgehängt, und am nächsten Morgen brachten sie das allerletzte Ergebnis, das der Polizeileutnant hätte erwarten können.
Während Monsieur Hérault in seinem Arbeitszimmer frühstückte, wurde der Graf de Villeneuve angekündigt, der ihn zu sprechen wünschte. Monsieur Hérault kannte ihn nur dem Namen nach, da er einer alten Familie in der Provence oder im Languedoc angehörte, und ließ ihn hereinführen. Es erschien ein perfekter Gentleman, gekleidet mit einer bewundernswerten Mischung aus Pracht und gutem Geschmack. Ich habe etwas nur für sie persönlich, Sir«, sagte der Graf. »Würden Sie anordnen, dass wir nicht gestört werden dürfen?«
Monsieur HĂ©rault gab die Befehle.
»Darf ich mich erkundigen, Herr Graf, was Ihr Anliegen ist?«, fragte er, als die Tür geschlossen war.
»Ich komme um die Belohnung zu verdienen, die Sie für die Ergreifung von Poulailler aussetzen«, antwortete der Graf.
»Ich bin Poulailler.«
Bevor Monsieur Hérault seine Lippen öffnen konnte, brachte der Räuber einen hübschen kleinen Dolch und eine rosafarbene Seidenschnur hervor. »Die Spitze dieses kleinen Dolches ist vergiftet«, bemerkte er; »und ein Kratzer davon, mein lieber Herr, würde Ihren Tod bedeuten.« Mit diesen Worten knebelte Poulailler den Polizeileutnant, fesselte ihn mit der rosafarbenen Kordel an seinen Stuhl und erleichterte sein Schreibpult um tausend Goldstücke. »Ich werde das Geld nehmen, anstatt den Platz im Büro einzunehmen, den Sie freundlicherweise anbieten«, sagte Poulailler. »Machen Sie sich nicht die Mühe, mich zur Tür zu begleiten. Guten Morgen.«
Ein paar Wochen später, während Monsieur Hérault noch immer in ganz Paris Gegenstand des Spottes war, führte Poulailler eine Geschäftsreise nach Lille und Cambrai. Der einzige Fahrgast im Bus war der ehrwürdige Dekan Potter aus Brüssel. Sie kamen ins Gespräch über das einzige interessante Thema der Zeit — nicht das Wetter, sondern Poulailler.
»Es ist eine Schande für die Polizei«, sagte der Dekan, »dass ein solcher Übeltäter immer noch auf freiem Fuß ist. Ich werde in zehn Tagen auf diesem Weg nach Paris zurückkehren, und ich werde Monsieur Hérault aufsuchen, um ihm einen Plan vorzuschlagen, wie man den Schurken fangen kann.«
»Darf ich fragen, wie das gehen soll?«, sagte Poulailler.
»Verzeihen Sie«, antwortete der Dekan; »Sie sind ein Fremder, Sir, und außerdem möchte ich das Verdienst, den Plan vorgeschlagen zu haben, für mich behalten.«
»Glauben Sie, dass der Polizeileutnant Sie vorlassen wird?«, fragte Poulailler; »er ist für Fremde nicht zugänglich, seit der Schurke, von dem Sie sprechen, ihm diesen Streich an seinem eigenen Frühstückstisch gespielt hat.«
»Er wird Dekan Potter in Brüssel vorlassen«, lautete die Antwort, mit dem geringsten Anflug von gekränkter Würde.
»Oh, zweifellos!« sagte Poulailler; »bitte entschuldigen Sie.«
»Gerne, Sir«, sagte der Dekan; und das Gespräch floss in andere Kanäle.
Neun Tage später wurde der verletzte Stolz von Monsieur Hérault durch einen bemerkenswerten Brief besänftigt. Einen sehr bemerkenswerten Brief. Er war von einem aus Poulaillers Bande unterzeichnet, der sich als Kronzeuge anbot, in der Hoffnung, eine Begnadigung zu erhalten. Der Brief besagte, dass der ehrwürdige Dekan Potter von Poulailler überfallen und ermordet worden war und dass der Räuber mit seiner üblichen Dreistigkeit im Begriff war, am nächsten Tag mit der Postkutsche nach Paris zurückzukehren, verkleidet in der Kleidung des Dekans und ausgestattet mit dessen eigenen Papieren. Monsieur Hérault ergriff seine Vorsichtsmaßnahmen, ohne einen Moment zu verlieren. Ausgewählte Männer wurden mit ihren Befehlen an der Schranke postiert, die die Kutsche passsieren musste, um nach Paris fahren, während der Polizeileutnant in seinem Büro wartete, in Begleitung von zwei französischen Herren, die über die Identität des Dekans Auskunft geben konnten, falls Poulailler frecherweise in der Annahme des Namens seines Opfers beharrte.
Zur verabredeten Stunde erschien die Kutsche, und aus ihr stieg ein Mann in der Tracht des Dekans. Er wurde trotz seiner Beteuerungen verhaftet; die Papiere des ermordeten Potters wurden bei ihm gefunden, und er wurde im Triumph zum Polizeibüro geschleppt. Die Tür öffnete sich, und der Posse Comitatus [eher wohl eine Art Hilfsscheriff / Polizeiaufgebot] trat mit dem Gefangenen ein. Sofort brachen die beiden Zeugen in einen Schrei des Erkennens aus und wandten sich entrüstet an den Polizeileutnant. »Gütiger Himmel, mein Herr, was haben Sie getan?« riefen sie entsetzt aus; »das ist nicht Poulailler — hier ist unser ehrwürdiger Freund; hier ist der Dekan selbst!« Im selben Moment trat ein Diener mit dem Brief ein:
»Dekan Potter. Zu Händen von Monsieur Hérault, Leutnant der Polizei.«
Der Brief war mit diesen Worten formuliert:
»Ehrwürdiger Herr, — profitieren Sie von der Lektion, die ich Ihnen erteilt habe. Seien Sie ein Christ für die Zukunft, und versuchen Sie nie wieder, einen Menschen zu verletzen, es sei denn, er versucht, Sie zu verletzen.
Mit freundlichen GrĂĽĂźen
Poulailler.«
Diese KunststĂĽcke kĂĽhler KĂĽhnheit wurden von anderen erreicht, in denen sich seine GroĂźzĂĽgigkeit gegenĂĽber dem Geschlecht so groĂźmĂĽtig wie eh und je geltend machte.
Als er eines Tages hörte, dass im Haus einer großen Dame, einer Madame De Brienne, große Geldsummen aufbewahrt wurden, deren Tür in Erwartung eines Besuchs des berühmten Diebes von einem Portier von anerkannter Vertrauenswürdigkeit und Mut bewacht wurde, nahm Poulailler sich vor, sie trotz ihrer Vorsichtsmaßnahmen auszurauben, was ihm auch gelang. Mit einem dicken Paar Lederriemen und Schnallen in der Tasche und zwei seiner Leute, die als Kutscher und Lakai verkleidet waren, folgte er Madame de Brienne eines Abends ins Theater. Kurz vor dem Ende der Vorstellung wurden der Kutscher und der Lakai der Dame von Poulaillers verkleideten Untergebenen für fünf Minuten weggelockt, um ein Glas Wein zu trinken. Es wurde kein Versuch unternommen, sie aufzuhalten oder ihnen den Schnaps abzunehmen. Aber in ihrer Abwesenheit war Poulailler unter die Kutsche geschlüpft, hatte seine Lederriemen um die Stange gehängt — einen zum Festhalten und einen zum Abstützen seiner Füße — und war nun mit diesen einfachen Vorbereitungen bereit, auf die Ereignisse zu warten. Madame de Brienne stieg in die Kutsche ein — der Lakai stieg hinten auf — Poulailler hängte sich waagerecht unter die Stange, und wurde unter diesen eigenartigen Umständen mit ihnen nach Hause gefahren. Er war stark genug, seine Position zu halten, nachdem die Kutsche in das Kutschenhaus gebracht worden war, und er verließ sie erst, als die Türen für die Nacht verschlossen wurden. Er hatte sich zuvor mit Nahrung versorgt, wartete er geduldig, versteckt im Kutschenhaus, zwei Tage und Nächte lang, auf seine Gelegenheit, in Madame de Briennes Boudoir zu gelangen.
Am dritten Abend ging die Dame auf einen großen Ball; die Dienerschaft ließ in ihrer Wachsamkeit nach, während sie ihr den Rücken zukehrte, und Poulailler schlich sich in das Zimmer. Er fand zweitausend Louisd'ors, was nicht die Summe war, die er erwartet hatte, und ein Taschenbuch, das er mitnahm, um es zu Hause zu öffnen. Es enthielt einige Optionsscheine für eine vergleichsweise geringe Summe. Poulailler war viel zu wohlhabend, um sich darum zu kümmern, sie anzunehmen, und viel zu höflich, wenn es sich um eine Dame handelte, um sie unter diesen Umständen nicht wieder zurückzuschicken. Dementsprechend erhielt Madame de Brienne ihre Optionsscheine mit einem Entschuldigungsschreiben des höflichen Diebes.
»Bitte entschuldigen Sie meinen Besuch in Ihrem reizenden Boudoir«,
schrieb Poulailler,
»in Anbetracht der falschen Berichte über Ihren Reichtum, die mich allein dazu bewogen haben, es zu betreten. Wenn ich gewusst hätte, wie Ihre Vermögensverhältnisse wirklich sind, wäre ich bei der Ehre eines Gentleman, Madame, unfähig gewesen, Sie zu berauben. Ich kann Ihnen Ihre 2000 Louisd'ors nicht per Post zurückschicken, wie ich Ihre Optionsscheine zurückschicke. Aber wenn Sie in Zukunft in Geldnöten sind, werde ich stolz darauf sein, einer so vornehmen Dame zu helfen, indem ich ihr aus meinen eigenen reichlichen Mitteln das Doppelte der Summe leihe, die ich ihr bei dieser Gelegenheit leider geraubt habe.«
Dieser Brief wurde dem Königshaus in Versailles gezeigt. Er erregte die höchste Bewunderung des Hofes — besonders der Damen. Wann immer der Name des Räubers erwähnt wurde, nannten sie ihn nachsichtig den »Chevalier de Poulailler«. Ach! Das war die Zeit der Höflichkeit, als man gute Erziehung auch bei einem Dieb anerkannte. Wer würde sie heute unter ähnlichen Umständen noch anerkennen? O tempora! O mores!
Bei einer anderen Gelegenheit war Poulailler eines Nachts unterwegs, um etwas frische Luft zu atmen und seine Möglichkeiten auf den Dächern der Häuser zu beobachten, wobei ein Mitglied der Bande unten auf der Straße postiert war, um ihm bei Bedarf beizustehen. Während er in dieser Lage war, hörte er ein Schluchzen und Stöhnen aus einem offenen Fenster der Hinterwohnung. Vor dem Fenster erhob sich eine Brüstung, durch die er hinaufklettern und hineinschauen konnte. Das Bild, das sich ihm bot, waren hungernde Kinder, die eine hilflose Mutter umringten und nach Essen schrien. Die Mutter war jung und schön, und Poulaillers Hand umklammerte unwillkürlich seine Geldbörse, als notwendige Konsequenz. Bevor der wohltätige Dieb durch das Fenster eintreten konnte, stürzte ein Mann mit entsetztem Gesicht durch die Tür und warf der schönen Mutter eine Handvoll Gold in den Schoß. »Meine Ehre ist dahin«, rief er, »aber unsere Kinder sind gerettet! Hören Sie sich die Umstände an. Ich traf einen Mann in der Straße unten; er war groß und dünn; er hatte eine grüne Augenklappe über einem Auge; er schaute verdächtig zu diesem Haus hinauf und wartete offenbar auf jemanden. Ich dachte an Sie — ich dachte an die Kinder — ich packte den verdächtigen Fremden am Kragen. Der Schrecken überwältigte ihn auf der Stelle.« »Nimm meine Uhr, mein Geld und meine zwei wertvollen goldenen Schnupftabakdosen«, sagte er, »aber verschone mein Leben.« »Ich nahm sie.« — »Edler Mann!« rief Poulailler, der am Fenster erschien. Der Mann schreckte auf, die Frau schrie, die Kinder versteckten sich. »Darf ich Sie bitten, gefasst zu bleiben«, fuhr Poulailler fort. »Sir! Ich betrete die Szene hier, um Ihr banges Gewissen zu beruhigen. Aus Ihrer anschaulichen Beschreibung erkenne ich den Mann, dessen Eigentum jetzt im Schoß Ihrer Frau liegt. Beruhigen Sie sich, Sie haben einen Räuber beraubt — mit anderen Worten, die Gesellschaft rehabilitiert. Nehmen Sie meinen Glückwunsch zu Ihrer wiederhergestellten Unschuld an. Der elende Feigling, dessen Kragen Sie ergriffen haben, gehört zu Poulaillers Bande. Er hat sein Diebesgut verloren, als gerechte Strafe für seinen schändlichen Mangel an Geist.«
» Wer sind Sie?«, rief der Ehemann.
»Ich bin Poulailler«, antwortete der illustre Mann mit der Schlichtheit eines alten Helden. Nehmen Sie diesen Geldbeutel und machen Sie mit dem Inhalt ein Geschäft. Es gibt ein Vorurteil, Sir, zugunsten der Ehrlichkeit. Geben Sie diesem Vorurteil eine Chance. Es gab eine Zeit, da habe ich es selbst gefühlt; ich bedaure, es nicht mehr zu fühlen. Unter allen Arten von Unglück bleibt dem ehrlichen Mann noch der Tros. Wo ist es geblieben? Hier!« Er schlug sich ans Herz, und die Familie fiel vor ihm auf die Knie.
» Wohltäter deiner Art!« rief der Ehemann; »wie kann ich Ihnen meine Dankbarkeit zeigen?«
»Sie können mir erlauben, die Hand von Madame zu küssen«, antwortete Poulailler.
Madame sprang auf und umarmte den großzügigen Fremden. »Was kann ich noch tun?« rief die schöne Frau eifrig aus; »O Himmel! was noch?«
Sie können Ihren Mann bitten, mir nach unten zu leuchten«, antwortete Poulailler. Er sprach, drückte ihre Hände, vergoss eine großzügige Träne und ging. In diesem rührenden Moment hätte ihn sein eigener Adoptivvater nicht erkannt.
Diese letzte Anekdote schließt den Bericht über Poulaillers Karriere in Paris ab. Die leichteren und angenehmeren Aspekte dieser Karriere wurden bisher bewusst dargestellt, in dezenter Erinnerung an den Kontrast, den die tragische Seite des Bildes nun darstellen muss. Komödie und Sentiment, Zwillingsschwestern französischer Abstammung, lebe wohl! Das Grauen tritt als nächstes auf die Bühne, und es tritt willkommen ein, im Namen des Adoptivsohns des Teufelsfischers.

IV.
Sein Abgang von der Szene.
Die Natur von Poulaillers ernsthafteren Errungenschaften in der Kunst des Raubes kann durch den Hinweis auf eine schreckliche Tatsache erkannt werden. In den polizeilichen Aufzeichnungen dieser Zeit werden mehr als hundertfünfzig Männer und Frauen gezählt, die durch die Hand von Poulailler und seiner Bande ums Leben gekommen sind. Es war nicht die Gewohnheit dieses furchterregenden Räubers, sowohl Leben als auch Eigentum zu nehmen, es sei denn, das Leben stand ihm direkt im Weg — in diesem Fall fegte er das Hindernis ohne Zögern und ohne Gewissensbisse sofort weg. Seiner tödlichen Entschlossenheit zu rauben, die von der Bevölkerung im Allgemeinen so empfunden wurde, entsprach seine tödliche Entschlossenheit für Gehorsam, die von seinen Anhängern im Besonderen empfunden wurde. Einer von ihnen zum Beispiel, der sich von seiner Treue losgesagt und danach versucht hatte, seinen Anführer zu verraten, wurde in seinem Versteck in einem Keller aufgespürt und dort in Poulaillers Anwesenheit lebendig eingemauert, wobei der Räuber das Epitaph des Unglücklichen verfasste und mit seiner eigenen Hand in den nassen Putz ritzte. Jahre später wurde die Inschrift bemerkt, als das Haus in den Besitz eines neuen Mieters überging, und man nahm an, dass es sich um einen der vielen Scherze handelte, die der berühmte Räuber zu seiner Zeit getrieben hatte. Als der Putz entfernt wurde, fiel das Skelett heraus und bezeugte, dass Poulailler es ernst meinte.
Die Festnahme eines solchen Mannes zu versuchen, indem man seine Anhängern zu manipulieren versucht, war praktisch unmöglich. Keine Geldsumme, die angeboten werden konnte, würde eines der Mitglieder seiner Bande dazu bewegen, das tödliche Risiko seiner Rache zu riskieren. Andere Mittel, um ihn gefangen zu nehmen, waren versucht worden, aber vergeblich. Fünfmal war es der Polizei gelungen, ihn in verschiedenen Verstecken aufzuspüren; und bei allen fünf Gelegenheiten hatten ihm die Frauen, die ihn wegen seiner Galanterie, seiner Großzügigkeit und seines guten Aussehens anbeteten, zur Flucht verholfen. Hätte er nicht unbewusst den Weg zu seiner eigenen Gefangennahme geebnet, indem er erstens mit Mademoiselle Wilhelmina de Kirbergen durchbrannte und zweitens sie schlecht behandelte, ist es mehr als zweifelhaft, ob der lange Arm des Gesetzes jemals weit genug gereicht hätte, um ihn zu fassen. Wie dem auch sei, die Extreme von Liebe und Hass trafen sich schließlich im Schoß der hingebungsvollen Wilhelmina, und die Rache einer vernachlässigten Frau vollbrachte, was die gesamte Pariser Polizei wozu die gesamte Pariser Polizei nicht in der Lage war.
Poulailler, der nie für die Beständigkeit seiner Anhänglichkeiten berühmt war, hatte schon früh die Begleiterin seiner Flucht aus Deutschland satt; aber Wilhelmina war eine jener Frauen, deren Zuneigung, einmal geweckt, kein Nein als Antwort akzeptiert. Sie hielt beharrlich an einem Mann fest, der aufgehört hatte, sie zu lieben. Poulaillers Geduld war erschöpft; er versuchte zweimal, sich seiner unglücklichen Geliebten zu entledigen — einmal durch das Messer, einmal durch Gift — und scheiterte beide Male. Zum dritten und letzten Mal, um ein Experiment anderer Art zu wagen, stellte er einen Nebenbuhler auf, um die deutsche Frau aus dem Haus zu vertreiben. Von diesem Moment an war sein Schicksal besiegelt. Von eifersüchtiger Wut geplagt, warf Wilhelmina die letzten Reste ihrer Zuneigung in den Wind. Sie kommunizierte heimlich mit der Polizei, und Poulailler traf sein Schicksal.
Es wurde eine Nacht mit den Behörden vereinbart, und der Räuber wurde von seiner verstoßenen Geliebten zu einem Abschiedsgespräch eingeladen. Sein schnödes Vertrauen in ihre Treue ließ ihn seine üblichen Vorsichtsmaßnahmen außer Acht lassen. Er nahm die Verabredung an, und die beiden nahmen ein gemeinsames Abendessen ein, wobei sie sich darauf einigten, dass sie fortan nur noch Freunde sein sollten und sonst nichts. Gegen Ende des Essens wurde Poulailler durch eine grauenhafte Veränderung im Gesicht seiner Begleiterin aufgeschreckt.
»Was ist los mit dir?«, fragte er.
»Eine Bagatelle«, antwortete sie und schaute auf ihr Weinglas. »Ich kann nicht anders, als dich immer noch zu lieben, so schlecht, wie du mich behandelt hast. Du bist ein toter Mann, Poulailler, und ich werde dich nicht überleben.«
Der Räuber sprang auf und griff nach einem Messer, das auf dem Tisch lag.
»Du hast mich vergiftet!«, rief er aus.
»Nein!« antwortete sie. »Gift ist meine Rache an mir selbst; und nicht meine Rache an dir. Du wirst dich von diesem Tisch erheben, wie du dich an ihn gesetzt hast. Aber dein Abend wird im Gefängnis beendet werden und dein Leben wird auf dem Rad enden.«
Während sie die Worte sprach, wurde die Tür von der Polizei aufgesprengt und Poulailler wurde in Verwahrung genommen. In derselben Nacht tat das Gift sein tödliches Werk, und seine Geliebte sühnte mit ihrem Leben für den ersten, den letzten Akt des Verrats, mit dem sie sich an dem Mann, den sie liebte, gerächt hatte.
Einmal sicher in den Händen der Justiz untergebracht, versuchte der Räuber, Zeit zu gewinnen, um ihr zu entkommen, indem er versprach, wichtige Offenbarungen zu machen. Das Manöver nutzte ihm nichts. In jenen Tagen hatten die Gesetze des Landes noch keine Bekanntschaft mit den Gesetzen der Menschlichkeit gemacht. Poulailler wurde auf die Folter gespannt — man ließ ihn sich erholen — er wurde öffentlich auf dem Rad zerbrochen — und wurde lebendig davon abgenommen, um in ein loderndes Feuer geworfen zu werden. Durch diese mörderischen Mittel entledigte sich die Gesellschaft eines Mörders, und die Müßiggänger auf den Boulevards machten ihren Abendspaziergang wieder in wiedergewonnener Sicherheit.
* *
*
Paris hatte die Hinrichtung von Poulailler gesehen; aber wenn man den Legenden trauen darf, haben unsere alten Freunde, die Leute des Fischerdorfes in der Bretagne, sein Ende danach gesehen. An dem Tag und zu der Stunde, als er umkam, verdunkelte sich der Himmel, und ein schrecklicher Sturm erhob sich. Noch einmal, und nur für einen Augenblick, rötete der Schimmer des unheimlichen Feuers die Fenster des alten Turms. Der Donner krachte und schlug das Gebäude in Stücke. Blitze zuckten unaufhörlich über die Ruinen, und im sengenden Schein der Blitze sah man, wie das Boot, das in früheren Jahren immer dann zur See fuhr, wenn der Sturm am stärksten war, aus der Felsspalte in den tobenden Ozean hinausschoss, und man entdeckte bei dieser letzten Gelegenheit, dass es doppelt bemannt war. Der Teufelsfischer saß am Steuer, sein Adoptivsohn zerrte an den Rudern, und ein teuflisches Stimmengewirr, das laut und furchtbar durch den Sturm brüllte, wünschte den beiden eine gute Fahrt.

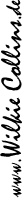
 Startseite
Startseite
 Neuigkeiten
Neuigkeiten Inhaltsverzeichnis aktuelle
Ăśbersetzung
Inhaltsverzeichnis aktuelle
Ăśbersetzung