
Die Frau in Weiß
Weitere Aussagen
Aussage der Elisa Michelsson, Haushälterin zu Blackwater Park
Man fordert mich auf, genau anzugeben, was ich über den Fortgang von Miß Halcombe’s Krankheit und über die Umstände weiß, unter welchen Lady Glyde Blackwater Park verließ, um nach London zu reisen.
Der Grund für diese Aufforderung ist, daß man meines Zeugnisses im Interesse der Wahrheit bedarf. Als Witwe eines Geistlichen der englischen Hochkirche (aber durch Unglück auf die Nothwendigkeit zurückgeführt, eine Stelle anzunehmen) habe ich gelernt, die Rechte der Wahrheit über alle anderen Rücksichten zu stellen. Ich füge mich daher einer Bitte, welche zu erfüllen ich andernfalls, um mich nicht an höchst betrübenden Familienangelegenheiten zu betheiligen, gezögert haben würde.
Ich habe mir damals kein Memorandum gemacht und kann deshalb mit Bestimmtheit kein Datum angeben; aber ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich sage, daß Miß Halcombe’s Krankheit in der ersten Woche des Juli begann. Man frühstückte spät in Blackwater Park, zuweilen erst um zehn, nie aber vor halb zehn Uhr. An dem Morgen, von dem ich jetzt spreche, erschien Miß Halcombe (die sonst fast immer zuerst unten war) nicht am Frühstückstische. Nachdem die Herrschaften eine Viertelstunde auf sie gewartet hatten, schickten sie das Oberstubenmädchen zu ihr hinaus, welches aber ganz erschrocken wieder aus der Stube gestürzt kam. Ich begegnete ihr auf der Treppe und ging sogleich in Miß Halcombe’s Zimmer, um zu sehen, was es gäbe. Die arme Dame war nicht im Stande, es mir zu sagen. Sie ging mit einer Feder in der Hand, phantasirend und in heftigem Fieber in der Stube auf und ab.
Lady Glyde (da ich nicht mehr in Sir Percival’s Diensten bin, darf ich, ohne die Schicklichkeit zu verletzen, meine frühere Herrin bei ihrem Namen nennen, anstatt Mylady zu sagen) war die Erste, die aus ihrem Schlafzimmer herbeieilte. Sie war so furchtbar bestürzt und ergriffen, daß eine Frage an sie vergebens gewesen wäre. Graf Fosco und seine Gemahlin, welche gleich nach ihr heraufkamen, waren beide äußerst dienstfertig und gütig. Die Frau Gräfin half mir, Miß Halcombe in ihr Bett zu legen, und Seine Gnaden der Herr Graf blieb im Wohnzimmer und nachdem er sich seinen Medicinkasten hatte bringen lassen, mischte er einen Trank und eine kühlende Waschung für ihren Kopf, damit keine Zeit verloren würde, bis der Arzt käme. Wir kühlten ihren Kopf mit der Waschung, konnten sie aber nicht überreden, die Medicin zu nehmen. Sir Percival erbot sich, den Arzt holen zu lassen. Er schickte einen Reitknecht zu Pferde an den nächsten Arzt ab, welcher Mr. Dawson zu Oak Lodge war.«
Mr. Dawson kam nach weniger als einer Stunde an. Er war ein achtbarer, ältlicher Mann, der in der ganzen Umgegend bekannt war, und wir waren sehr erschrocken, als er den Anfall einen höchst ernsten nannte. Seine Gnaden der Herr Graf unterhielt sich sehr freundlich mit Mr. Dawson und sprach seine Ansichten mit einer verständigen Unbefangenheit aus, Mr. Dawson frug – nicht sehr höflich – ob der Rath des Herrn Grafen der Rath eines Arztes sei, und als Seine Gnaden ihm sagte, es sei der Rath eines Mannes, welcher die Medicin aus Liebhaberei studirt, entgegnete er, daß er nicht gewohnt sei, Consultationen mit Dilettanten-Aerzten zu halten, Der Graf lächelte mit echt christlicher Milde und verließ das Zimmer. Doch ehe er ging, sagte er mir, falls man seiner im Verlaufe des Tages bedürfe, würde er im Boothause beim See zu finden sei. Warum er gerade dorthin ging, kann ich nicht sagen. Jedenfalls aber ging er und blieb den ganzen Tag bis Abends sieben Uhr, wo man zu Tische ging, fort. Vielleicht wollte er das Beispiel geben, Alles im Hause so ruhig wie möglich zu halten. Es lag dies ganz in seinem Charakter. Er war ein außerordentlich rücksichtsvoller Herr.
Miß Halcombe verbrachte eine sehr schlimme Nacht, während welcher das Fieber abwechselnd kam und ging und gegen Morgen, anstatt sich zu legen, schlimmer wurde. Da in der Nachbarschaft keine Krankenwärterin zu finden war, die sie hätte pflegen können, übernahmen Ihre Gnaden die Frau Gräfin und ich diese Pflicht, indem wir einander ablösten. Lady Glyde war unweise genug, darauf zu bestehen, mit uns aufzusitzen. Sie war viel zu nervenschwach und bei zu schlechter Gesundheit, um die Besorgniß um Miß Halcombe mit Ruhe zu ertragen. Sie that sich bloß selbst Schaden, ohne ihrer Schwester von dem geringsten Nutzen zu sein. Es hat gewiß nie eine sanftere, liebevollere Dame gelebt, aber sie weinte und ängstigte sich – zwei Schwachheiten, die sich durchaus nicht für Krankenstuben eignen.
Sir Percival und der Graf kamen am Morgen, um sich nach dem Befinden zu erkundigen. Sir Percival schien mir (wahrscheinlich aus Kummer über den Schmerz seiner Gemahlin und über Miß Halcombe’s Krankheit) sehr verwirrt und unruhig. Der Herr Graf dagegen bewies eine sehr angemessene Fassung und Theilnahme. Er hielt seinen Strohhut in der einen und ein Buch in der andern Hand, und ich hörte ihn zu Sir Percival sagen, er werde wieder nach dem Boothause gehen, um zu studiren. »Laß uns alle mögliche Ruhe im Hause halten,« sagte er, »laß uns nicht im Hause rauchen, mein Freund, jetzt da Miß Halcombe krank ist. Geh’ Du Deiner Wege, und ich will meiner Wege gehen. Wenn ich studire, bin ich am liebsten allein. Guten Morgen, Mrs. Michelson.«
Sir Percival war nicht höflich genug –vielleicht wäre es besser, wenn ich sagte: nicht gefaßt genug – mich mit derselben höflichen Aufmerksamkeit zu grüßen. In der That die einzige Person im ganzen Hause, welche mir damals oder je auf dem Fuße einer Dame in zurückgekommenen Verhältnissen begegnete, war der Graf. Sein Benehmen war das eines wahren Edelmannes: er war rücksichtsvoll gegen Alle. Sogar das junge Frauenzimmer, (Fanny hieß sie) welches Lady Glyde bediente, stand nicht zu tief unter seiner Beachtung. Als Sir Percival sie fortschickte, war der Herr Graf (der mir eben seine allerliebsten kleinen Vögel zeigte) auf das Freundlichste besorgt, zu wissen, was aus ihr geworden, wo sie den Tag zubringen werde, bis sie Blackwater Park verlassen könne, und dergleichen mehr. Es ist hauptsächlich in solchen zarten kleinen Aufmerksamkeiten, daß sich die Vorzüge aristokratischer Geburt am deutlichsten zeigen. Ich mache keine Entschuldigungen wegen Anführung dieser Einzelheiten; ich erwähne ihrer absichtlich, um dem Herrn Grafen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, da ich weiß, daß gewisse Leute seinen Charakter in einem etwas unvortheilhaften Lichte sehen. Ein Edelmann, der eine Dame in zurückgekommenen Verhältnissen achten und väterliche Theilnahme an dem Schicksale einer armen Kammerjungfer bezeigen kann, beweist, daß er Grundsätze von zu erhabener Natur besitzt, als daß man sie auf leichtfertige Weise in Zweifel ziehen könnte. Ich enthalte mich aller Ansichten und beschränke mich auf bloße Thatsachen. Es ist mein Lebelang mein Bestreben gewesen, nicht zu richten, auf daß ich nicht gerichtet werde. Es bildete dies den Text zu einer der schönsten Predigten meines lieben Mannes. Ich lese diese Predigt wiederholt – in meinem eigenen Exemplare der in den ersten Wochen meines Witwenstandes auf Subscription gedruckten Ausgabe – und sie gewährt mir jedesmal erneuerte geistige Erquickung und Erbauung.
Miß Halcombe’s Zustand besserte sich nicht, und die zweite Nacht war wo möglich noch schlimmer, als die erste. Mr. Dawson kam mit regelmäßiger Beständigkeit. Die praktischen Pflichten des Pflegens wurden noch immer von der Frau Gräfin und mir getheilt, während Lady Glyde darauf bestand, mit uns aufzusitzen, obgleich wir Beide sie auf das Dringendste baten, sich etwas Erholung zu gönnen. »Mein Platz ist an Mariannen’s Bette,« war ihre einzige Antwort, »und ob ich krank bin oder wohl – Nichts soll mich bewegen, sie aus den Augen zu verlieren.«
Gegen Mittag ging ich hinunter, um einigen meiner regelmäßigen Pflichten nachzukommen. Eine Stunde später, als ich wieder ins Krankenzimmer zurückkehrte, sah ich den Grafen (welcher zum dritten Male früh des Morgens ausgegangen war) in den Flur kommen, und zwar dem Anscheine nach in der besten Laune. Sir Percival steckte zu gleicher Zeit den Kopf durch die Thür der Bibliothek und sagte mit großem Eifer folgende Worte zu seinem hohen Freunde:
»Hast Du sie gefunden?«
Ein zufriedenes Lächeln zeichnete tausend Grübchen in Seiner Gnaden großem Gesichte, aber er gab keine Antwort. In demselben Augenblicke wandte Sir Percival den Kopf um, sah, daß ich auf die Treppe zuging, und blickte mich auf höchst ungezogene, zornige Weise an.
»Komm hier herein und erzähle mir das Ganze,« sagte er zum Grafen. »Wenn man Weiber im Hause hat, kann man stets sicher sein, sie auf den Treppen zu sehen.«
»Mein lieber Percival,« sagte der Graf gütig, »Mrs. Michelson hat ihre Pflichten. Ich bitte Dich, sie für ihre höchst bewunderungswürdige Ausübung derselben zu achten, wie ich es thue. Wie geht es unserer Leidenden, Mrs. Michelson?«
»Nicht besser, Mylord, wie ich zu meinem Bedauern sagen muß.«
»Traurig – sehr traurig!« sagte der Graf. »Sie sehen angegriffen aus, Mrs. Michelson. Es ist wirklich ·Zeit, daß Sie und meine Frau Hülfe in der Pflege bekommen. Ich denke, daß ich im Stande sein werde, Ihnen diese Hülfe zu verschaffen. Es haben sich Sachen zugetragen, welche die Gräfin Fosco nöthigen werden, entweder morgen oder übermorgen nach London zu reisen, Sie wird früh abreisen und Abends zurückkehren und wird zu ihrer Ablösung eine Krankenwärterin mitbringen, welche vorzügliche Eigenschaften als solche besitzt und augenblicklich frei ist. Sie ist meiner Frau als eine Person bekannt, auf die man sich unbedingt verlassen kann. Bitte, sprechen Sie hierüber nicht zu dem Arzte, ehe sie da ist; denn er wird eine Krankenwärterin meiner Wahl jedenfalls mit scheelem Auge ansehen. Sobald sie aber im Hause erscheint, wird sie für sich selber sprechen, und Mr. Dawson wird genöthigt sein, zuzugeben, daß man keine Entschuldigung haben würde, falls man sich nicht ihrer bediente. Lady Glyde wird dasselbe sagen. Bitte, bestellen Sie Lady Glyde meine besten Empfehlungen und versichern sie meiner aufrichtigsten Theilnahme.«
Ich sprach meine dankbare Anerkennung für Sr. Gnaden gütige Rücksichten aus, Sir Percival unterbrach mich jedoch (ich bedaure, sagen zu müssen, daß er sich dabei eines profanen Ausdruckes bediente) und rief seinem hohen Freunde zu, in die Bibliothek zu kommen und ihn nicht ewig warten zu lassen.
Ich ging die Treppe hinauf. Wir sind arme, irrende Geschöpfe, und wie fest auch die Grundsätze einer Frau sein mögen, sie schützen sie nicht immer gegen die Versuchung einer müßigen Neugier. Es beschämt mich aufrichtig, bekennen zu müssen, daß auch meine Grundsätze bei dieser Gelegenheit einer eitlen Neugier unterlagen, welche mich unpassend wißbegierig über die Frage machte, die Sir Percival von der Thür aus an seinen Freund gerichtet hatte. Wen sollte der Graf während seiner Morgenstudien im Parke gefunden haben? Ein weibliches Wesen, nach Sir Percival’s Ausdrücken zu urtheilen. Ich traute dem Grafen keine Unschicklichkeit zu – dazu kannte ich seinen moralischen Charakter zu gut. Die einzige Frage, die ich mir wiederholte, war: hatte er sie gefunden?
Doch ich fahre fort. Die Nacht verging abermals, ohne Miß Halcombe Besserung zu bringen. Am folgenden Tage schien sie sich jedoch ein wenig zu erholen. Am Morgen darauf reiste die Frau Gräfin, ohne daß ich sie zu irgend Jemanden den Zweck ihrer Reise hatte erwähnen hören, mit dem ersten Zuge nach London, und ihr hoher Gemahl begleitete sie mit seiner gewohnten Aufmerksamkeit zur Station.
Es war jetzt Miß Halcombe’s Pflege mir ganz allein überlassen und zugleich die Aussicht, da ihre Schwester trotz aller Ueberredung nicht von ihrem Bette weichen wollte, zunächst auch Lady Glyde in Pflege zu bekommen.
Der einzige Umstand von Wichtigkeit; welcher sich im Verlaufe des Tages zutrug, war ein abermaliger Wortstreit zwischen dem Grafen und dem Arzte.
Als Se. Gnaden von der Eisenbahnstation zurückkehrte, kam derselbe in Miß Halcombe’s Wohnzimmer hinaus, um sich, wie gewöhnlich, nach ihrem Befinden zu erkundigen. Ich ging hinaus, um mit ihm zu sprechen, da Lady Glyde sowohl, wie Mr. Dawson in dem Augenblicke bei der Kranken waren. Der Herr Graf legte mir viele Fragen in Bezug auf die Behandlung und die Symptome vor. Ich sagte ihm, daß die Behandlung die sei, welche man mit dem Ausdrucke »salinisch« bezeichne, und daß die Symptome zwischen den Fieberanfällen allerdings auf eine zunehmende Schwäche und Erschöpfung hindeuteten. Gerade, als ich dieses letzten Umstandes erwähnte, trat Mr. Dawson aus dem Schlafzimmer.
»Guten Morgen, Sir,« sagte Se. Gnaden, indem er höchst leutselig auf den Doctor zuging und ihm mit einer vornehmen Entschlossenheit den Weg vertrat, die vollkommen unwiderstehlich war. »Ich fürchte sehr, daß Sie noch immer keine Besserung in den Symptomen gefunden haben?«
»Ich finde im Gegentheil eine entschiedene Besserung,« sagte Mr. Dawson.
»Sie bestehen also noch immer auf Schwächung in diesem Fieberanfalle?« fuhr Se. Gnaden fort.
»Ich bestehe auf einer Behandlung, welche ich durch Berufserfahrungen gerechtfertiget finde,« sagte Mr. Dawson.
»Erlauben Sie mir eine Frage in Bezug auf den umfassenden Gegenstand von Berufserfahrungen,« sagte der Graf. »Ich unterstehe mich nicht, Ihnen Rath anzubieten – nur, eine Frage an Sie zu richten. Sie leben in einiger Entfernung, Sir, von den gigantischen Mittelpunkten wissenschaftlicher Thätigkeit: von London und Paris. Haben Sie nicht davon gehört, daß man die schwächende Wirkung des Fiebers dadurch wieder gut zu machen sucht, daß man den erschöpften Patienten durch Rum, Wein, Ammonium oder Chinin stärkt? Ist diese neue Ketzerei der höchsten medicinischen Autoritäten je bis zu Ihren Ohren gedrungen oder nicht?«
»Sobald ein practischer Arzt mir diese Frage vorlegt, werde ich das Vergnügen haben, ihm dieselbe zu beantworten,« sagte der Doctor, indem er die Thür öffnete, um hinaus zu gehen. »Sie sind kein practischer Arzt und werden mich entschuldigen, wenn ich Ihnen nicht darauf antworte.«
Indem der Graf diesen unverzeihlich unhöflichen Streich auf den einen Backen hinnahm, hielt er augenblicklich als echter Christ auch den zweiten hin und sagte mit aller Freundlichkeit: »Guten Morgen, Mr. Dawson.«
Wenn mein lieber verstorbener Mann das Glück gehabt hätte, Se. Gnaden zu kennen, wie sehr würden er und der Herr Graf einander da geachtet haben!
Ihro Gnaden die Frau Gräfin kehrte an demselben Abende mit demselben Zuge wieder zurück und brachte die Krankenwärterin aus London mit. Man sagte mir, daß der Name dieser Person Mrs. Rubelle sei. Ihr Aussehen und ihr unvollkommenes Englisch belehrten mich, daß sie eine Ausländerin sei.
Ich habe mich stets bemüht, eine menschenfreundliche Nachsicht für Ausländer zu fühlen. Sie besitzen nicht unsere Segnungen und Vortheile und sind meistens in den blinden Irrthümern des Papstthumes aufgewachsen. Es ist außerdem stets mein Grundsatz und meine Gewohnheit gewesen, wie es auch meines lieben Mannes Grundsatz und Gewohnheit war (siehe Predigt XXIX in der Sammlung Sr. Ehrwürden weiland Samuel Michelson’s, Dr. ph.), Andere so zu behandeln, wie ich von ihnen behandelt zu werden wünsche. Deshalb erwähne ich hier Nichts darüber, daß Mrs. Rubelle mir als eine kleine, steife, listige Person von ungefähr funfzig Jahren auffiel, mit einer dunkeln, braunen oder creolische Hautfarbe und wachsamen, hellgrauen Augen, noch daß ihr Anzug, obgleich derselbe aus der einfachsten schwarzen Seide bestand, für eine Person in ihrer Stellung von unpassend schwerem Stoffe und mit unnöthig geschmackvollem Besatze verziert war. Ich möchte nicht, daß so Etwas von mir gesagt würde, und es ist daher meine Pflicht, es auch nicht von Mrs. Rubelle zu sagen. Ich will blos erwähnen, daß ihr Wesen – wenn nicht gerade unangenehm steif – aber doch auffallend ruhig und zurückhaltend war; daß sie viel umherblickte und sehr wenig sprach, was natürlich ebenso sehr die Folge ihrer Bescheidenheit, als des Mißtrauens gegen ihre Stellung in Blackwater Park sein mochte; und daß sie das Abendessen ausschlug (was vielleicht sonderbar war, aber doch nicht verdächtig?), obgleich ich selbst sie mit der größten Höflichkeit einlud, dieses Mahl in meinem Zimmer mit mir zu theilen.
Auf des Grafen besonderen Wunsch (und dies war wieder Sr. Gnaden Versöhnlichkeit so ähnlich!) wurde bestimmt, daß Mrs. Rubelle ihre Pflichten nicht eher beginnen solle, als bis der Arzt sie am nächsten Morgen gesehen und seine Zustimmung gegeben habe. Ich wachte diese Nacht. Lady Glyde schien sehr dagegen, daß die neue Wärterin zu Miß Halcombe gelassen würde. Ein solcher Mangel an Rücksicht gegen eine Fremde von Seiten einer Dame ihrer Erziehung und feinen Bildung überraschte mich. Ich wagte die Bemerkung: »Mylady, wir sollten nicht voreilig in unserm Urtheile über untergeordnete Personen sein – namentlich, wenn dieselben aus fremdem Lande kommen.« Lady Glyde schien nicht auf mich zu achten. Sie seufzte blos und küßte Miß Halcombe’s Hand, welche auf der Bettdecke ruhte. Kein sehr vernünftiges Benehmen in einer Krankenstube und mit einer Patientin, die man so wenig als möglich aufregen sollte. Aber die arme Lady Glyde verstand Nichts vom Krankenpflegen – durchaus gar Nichts, wie ich zu meinem Bedauern gestehen muß.
Am folgenden Morgen wurde Mrs. Rubelle in das Wohnzimmer geschickt, um von dem Arzte in Augenschein genommen zu werden, wenn er durch dasselbe in Miß Halcombe’s Schlafzimmer gehen würde. Ich ließ Lady Glyde bei Miß Halcombe, welche in diesem Augenblicke in sanftem Schlummer lag, und ging zu Mrs. Rubelle, damit sie sich in Bezug auf die Ungewißheit ihrer Lage nicht fremd und ängstlich fühlen möge. Sie schien es jedoch nicht in diesem Lichte zu sehen. Sie schien schon vorher vollkommen überzeugt, daß Mr. Dawson ihre Dienste annehmen – werde, und setzte sich ruhig ans Fenster, wo sie sich allem Anscheine nach sehr an der frischen Landluft erquickte. Manche Leute hätten in diesem Benehmen vielleicht eine freche Sicherheit gesehen. Ich bitte jedoch zu bemerken, daß ich nicht so lieblos war und vielmehr einen ungewöhnlich starken Geist darin erkannte.
Anstatt daß der Arzt zu uns herauf kam, ließ man mich zum Arzte rufen. Mir erschien diese Veränderung der Dinge etwas sonderbar, aber Mrs. Rubelle schien vollkommen unberührt dadurch. Als ich sie verließ, saß sie noch immer ruhig am Fenster und erquickte sich schweigend an der Landluft.
Mr. Dawson erwartete mich allein im Frühstückszimmer.
»In Betreff dieser neuen Wärterin, Mrs. Michelson, …« sagte der Doctor.
»Ja, Sir?«
»… Höre ich, daß die Frau jenes dicken alten Ausländers, der sich fortwährend in meine Angelegenheiten mischt, sie mit aus London gebracht hat. Mrs. Michelson, der dicke alte Ausländer ist ein Quacksalber.«
Dies war sehr grob, und ich war natürlich entrüstet darüber.
»Wissen Sie, Sir,« sagte ich, »daß Sie von einem Edelmann sprechen?«
»Bah! Er ist nicht der erste Quacksalber, der einen Titel besessen hätte. Die bestehen aus lauter Grafen – zum Henker mit ihnen!«
»Er würde nicht der Freund von Sir Percival Glyde sein, Sir, wenn er nicht der höchsten Aristokratie – die englische natürlich ausgenommen – angehörte.«
»Schon gut, Mrs. Michelson, nennen Sie ihn, wie Sie wollen, und lassen Sie uns wieder auf die Wärterin zurückkommen. Ich habe bereits Einwendungen gegen sie gemacht.«
»Ohne sie gesehen zu haben, Sir?«
»Ja wohl; ohne sie gesehen zu haben. Sie mag sie beste Wärterin von der Welt sein, aber sie ist nicht die Wärterin meiner Wahl. Ich habe diese Einwendung gegen Sir Percival als den Herrn des Hauses gemacht. Aber er stimmt mir nicht bei. Er sagt, eine Wärterin meiner Wahl würde ebensogut eine Fremde aus London gewesen sein, und er meint, wir müßten’s mit der Frau versuchen, nachdem Lady Glyde’s Tante sich die Mühe genommen, sie aus London zu holen. Das ist eigentlich billig, und ich kann nicht wohl Nein sagen. Aber ich habe es zur Bedingung gemacht, daß sie augenblicklich fortgeschickt wird, sowie ich Ursache finde, unzufrieden mit ihr zu sein. Da dies ein Vorschlag ist, zu dem ich als ärztlicher Rathgeber berechtigt bin, so hat Sir Percival seine Einwilligung dazu gegeben. Jetzt, Mrs. Michelson, weiß ich, daß ich mich auf Sie verlassen kann, und ich fordere Sie deshalb auf, die Wärterin während der ersten paar Tage scharf zu beobachten und danach zu sehen, daß sie Miß Halcombe keine Medicin giebt, die ich nicht verordnet habe. Dieser ausländische Edelmann, für den Sie solche Bewunderung hegen, stirbt vor Sehnsucht, seine Quacksalbereien (unter andern auch den Magnetismus) an meiner Patientin zu versuchen, und eine Wärterin, die seine Frau hergebracht hat, mag nur zu bereit sein, ihm zu helfen. Verstehen Sie mich? Gut, dann können wir hinauf gehen. Ist die Wärterin da? Ich will mit ihr sprechen, ehe sie ins Krankenzimmer geht.«
Wir fanden Mrs. Rubelle noch an derselben Stelle, wo ich sie verlassen. Als ich sie dem Arzte vorstellte, schien sie weder durch seine zweifelhaften Blicke, noch durch seine scharfen Fragen im Geringsten verlegen zu werden. Sie antwortete ihm mit großer Ruhe in gebrochenem Englisch, und obgleich er Alles that, um sie verwirrt zu machen, verrieth sie soweit doch nicht die kleinste Unwissenheit über ihre Pflichten. Dies war ohne Zweifel eine Folge von Geistesstärke, und durchaus nicht von frecher Sicherheit, wie ich schon vorhin bemerkte.
Wir gingen Alle ins Schlafzimmer. Mrs. Rubelle blickte die Kranke sehr aufmerksam an; verbeugte sich gegen Lady Glyde, ordnete ein paar Gegenstände im Zimmer und nahm dann ruhig in einem Winkel Platz, bis man ihrer bedürfen würde. Mylady schien erschrocken und verdrießlich über das Eintreten der fremden Wärterin. Niemand sprach aus Besorgniß, Miß Halcombe, die noch immer schlummerte, aufzuwecken – ausgenommen der Doctor, der sich flüsternd erkundigte, wie sie die Nacht zugebracht habe. Ich antwortete leise, »ziemlich wie gewöhnlich,« worauf Mr. Dawson hinausging. Lady Glyde folgte ihm, vermuthlich um mit ihm über Mrs. Rubelle zu sprechen. Was mich betraf, so war ich bereits mit mir darüber einig geworden, daß diese ruhige fremde Person ihre Stelle behaupten werde. Sie nahm sich ersichtlich sehr zusammen und verstand jedenfalls ihr Geschäft. Bis dahin hätte ich selbst kaum bessere Dienste am Bette leisten können.
Indem ich mich der mir von Mr. Dawson gegebenen Warnung erinnerte, beobachtete ich Mrs. Rubelle während der ersten drei bis vier Tage in gewissen Zwischenräumen sehr scharf. Ich trat zu wiederholten Malen leise und plötzlich ins Zimmer, ertappte sie aber nie bei irgend einer verdächtigen Handlung. Lady Glyde, welche sie ebenso aufmerksam beobachtete, wie ich, wurde ebenfalls nie Etwas gewahr. Ich bemerkte nie, daß die Medicinflaschen vertauscht waren; ich sah Mrs. Rubelle nie ein Wort zu dem Grafen sprechen, noch den Grafen zu ihr. Sie behandelte Miß Halcombe unbestritten mit Sorgfalt und Umsicht. Die arme Dame schwankte zwischen einer Art schläfriger Erschöpfung, die halb Ohnmacht und halb Schlummer war, und Anfällen von Fieber hin und her, die mehr oder weniger von Geistesverwirrung begleitet waren. Mrs. Rubelle störte sie in ersterem Zustande niemals, noch erschreckte sie dieselbe in letzterem, indem sie zu plötzlich in ihrer Eigenschaft als Fremde ans Bett getreten wäre. Ehre dem Ehre gebühret (sei es nun ein Engländer oder ein Ausländer) – ich muß Mrs. Rubelle mein unparteiisches Lob geben. Sie war außerordentlich wenig mittheilsam über sich selbst und auf eine zu entschiedene Weise unabhängig von dem Rathe erfahrener Leute, welche die Pflichten eines Krankenzimmers kannten – aber sie war dessenungeachtet eine gute Krankenwärterin, und niemals fanden weder Lady Glyde noch Mr. Dawson den Schatten einer Ursache, unzufrieden mit ihr zu sein.
Der nächste Umstand von Wichtigkeit, welcher sich im Hause ereignete, war eine kurze Abwesenheit des Grafen, der in Geschäften nach London gerufen wurde. Er reiste am vierten Tage (glaube ich) nach Mrs. Rubelle’s Ankunft ab und sprach beim Abschiede sehr ernstliche Worte zu Lady Glyde in Rücksicht auf Miß Halcombe.
»Vertrauen Sie Mr. Dawson noch ein paar Tage länger, wenn Sie wollen,« sagte er. »Falls sich aber dann noch keine Besserung spüren läßt, da lassen Sie sofort geschickten ärztlichen Beistand aus London kommen, den dieser Maulesel von einem Doctor annehmen muß, ob er nun will oder nicht. Beleidigen Sie Mr. Dawson und retten Sie Miß Halcombe. Ich sage dies im Ernste, auf mein Ehrenwort und aus dem Grunde meines Herzens·«
Se. Gnaden sprach mit tiefem Gefühle und großer Güte. Die Nerven der armen Lady Glyde waren in dem Grade erschüttert, daß sie ganz erschrocken vor ihm schien. Sie zitterte am ganzen Körper und ließ ihn gehen, ohne ein einziges Wort zu erwidern. Sie wandte sich zu mir, als er fort war, und sagte: »O, Mrs. Michelson, mir bricht das Herz um meine Schwester, und ich habe keinen Freund, mit dem ich mich berathen könnte. Glauben Sie, daß Mr. Dawson sich täuscht? Er sagte mir heute Morgen selbst, es sei keine Gefahr mehr da und keine Nothwendigkeit, ferneren Rath herbeizurufen.«
»Mit aller Achtung vor Mr. Dawson,« sagte ich, »würde ich doch an Ew. Gnaden Stelle nicht des Herrn Grafen Rath vergessen.«
Lady Glyde wandte sich plötzlich und mit einem Ausdrucke der Verzweiflung von mir ab, den ich mir nicht zu erklären vermochte.
»Seinen Rath!« sagte sie zu sich selbst. »Gott helfe uns – seinen Rath!«
Der Graf blieb, soviel ich mich entsinne, wohl beinah eine Woche von Blackwater Park abwesend.
Sir Percival schien in manchen Beziehungen den Verlust seines Freundes zu empfinden, und auch, wie mir schien, sehr gedrückt und verstimmt zu sein über die Krankheit und Sorge im Hause. Zuweilen war er so unruhig, daß ich nicht umhin konnte, es zu bemerken; er kam und ging und wanderte dann fortwährend in den Anlagen umher. Seine Erkundigungen nach Miß Halcombe und seiner Gemahlin (deren schwankende Gesundheit ihm aufrichtige Besorgniß zu verursachen schien) waren unausgesetzt. Ich glaube, sein Herz war sehr erweicht. Wäre ein geistlicher Freund – etwa ein solcher, wie Sir Percival ihn in meinem verstorbenen, vortrefflichen Manne gefunden haben würde – um diese Zeit um ihn gewesen, so hätte dies erfreulichen moralischen Einfluß auf Sir Percival üben müssen. Ich täusche mich selten in einem Punkte dieser Art, da ich in meinen glücklichen Tagen des Ehestandes Erfahrungen gemacht habe, die mich leiten.
Ihro Gnaden die Frau Gräfin, die jetzt die einzige Gesellschaft für Sir Percival unten war, vernachlässigte ihn einigermaßen, wie es mich dünkte. Oder vielleicht vernachlässigte er sie. Ein Fremder hätte fast vermuthen können, daß diese Beiden, jetzt, wo sie allein waren, einander förmlich auswichen. Dies konnte natürlich nicht der Fall sein. Aber dennoch machte es sich so, daß die Gräfin stets das Gabelfrühstück zu ihrem Diner machte und gegen Abend hinauf kam, obgleich Mrs. Rubelle ihr jetzt die Pflichten der Pflege ganz abgenommen hatte. Sir Percival speiste allein, und ich hörte William (den Bedienten in Civil) die Bemerkung machen, daß sein Herr nur halbe Rationen an Speise, aber doppelte an Wein zu sich nehme. Ich lege solchen impertinenten Bemerkungen von Bedienten keine Wichtigkeit bei. Ich verwies ihm dieselbe damals und wünsche hiermit zu verstehen zu geben, daß ich sie auch jetzt noch tadle.
Im Verlaufe der nächsten paar Tage schien es uns allerdings Allen, als ob Miß Halcombe sich ein wenig erholte. Unser Zutrauen zu Mr. Dawson erwachte wieder; er schien mir voll Zuversicht zu sein und versicherte Lady Glyde, als sie mit ihm über die Sache sprach, daß er selbst vorschlagen würde, noch einen Arzt herbeizurufen, sobald er nur den Schatten eines Zweifels in sich erwachen fühlte.«
Die Einzige von uns, der diese Worte keine Beruhigung zu sein schienen, war die Gräfin. Sie sagte heimlich zu mir, daß sie sich nach Mr. Dawson’s Reden nicht über Miß Halcombe’s Zustand beruhigen könne, und daß sie voll Besorgniß der Rückkehr ihres Mannes entgegensehe, um dessen Meinung zu hören. Diese Rückkehr sollte, wie sie seine Briefe unterrichteten, in drei Tagen stattfinden. Der Herr Graf und die Frau Gräfin unterhielten während der Abwesenheit des Ersteren einen regelmäßigen täglichen Briefwechsel. Sie waren in dieser Beziehung, wie in jeder andern, ein Muster für alle Eheleute.
Am Abend des dritten Tages bemerkte ich eine Veränderung an Miß Halcombe, die mich ernstlich besorgt machte. Mrs. Rubelle bemerkte dieselbe ebenfalls. Wir sagten indessen Nichts davon zu Lady Glyde, die, völlig von Erschöpfung überwältigt, auf dem Sopha im Wohnzimmer eingeschlafen war.
Mr. Dawson machte seinen Abendbesuch später als gewöhnlich. Sowie er seiner Patientin ansichtig wurde, sah ich, daß sich sein Gesicht veränderte. Er versuchte, dies zu verbergen; aber er sah sowohl verlegen als erschrocken aus Es wurde ein Bote nach seiner Wohnung geschickt, um seinen Arzneikasten zu holen, desinficirende Vorkehrungen wurden im Zimmer angewandt, und es wurde ihm auf seine eigene Anordnung im Hause ein Bett gemacht. »Ist das Fieber ansteckend geworden?« flüsterte ich ihm zu. »Ich fürchte es,« entgegnete er; »doch werden wir morgen früh besser im Stande sein, darüber zu urtheilen.«
Auf Mr. Dawson’s eignen Befehl wurde Lady Glyde über diese beunruhigende Veränderung in Unwissenheit gelassen. Er selbst verbot ihr aus Rücksicht für ihre Gesundheit, diesen Abend zu uns ins Schlafzimmer zu kommen. Sie versuchte, sich dem zu widersetzen – es gab eitlen traurigen Auftritt – aber es unterstützte ihn seine ärztliche Autorität, und er gewann die Oberhand·
Nächsten Morgen um elf Uhr wurde einer der Bedienten mit einem Briefe an einen Arzt in London abgeschickt, mit dem Befehle, den neuen Doctor mit dem nächstmöglichen Zuge mit zurückzubringen. Eine halbe Stunde nachdem der Bote fort war, langte der Graf wieder in Blackwater Park an.
Die Gräfin brachte ihn sogleich auf eigene Verantwortung herein, um die Kranke zu sehen. Ich sah in diesem Verfahren durchaus nichts Unpassendes. Se. Gnaden war ein verheiratheter Mann und alt genug, um Miß Halcombe’s Vater zu sein; außerdem sah er sie in Gegenwart einer weiblichen Anverwandten, der Tante von Lady Glyde. Dennoch aber protestirte Mr. Dawson gegen seine Anwesenheit im Zimmer, aber ich konnte deutlich wahrnehmen, daß der Doctor selbst zu sehr beunruhigt war, um bei dieser Gelegenheit ernstlichen Widerstand zu bieten.
Die arme kranke Dame kannte Niemanden mehr von Denen, die sie umgaben. Sie schien ihre Freunde für Feinde anzusehen. Als der Graf sich ihrem Bette nahte, heftete sie ihre Augen, die bisher wild umher gewandert waren, mit einem so furchtbaren Stieren des Entsetzens auf sein Gesicht, daß ich es bis zu meiner letzten Stunde nicht vergessen werde. Der Graf setzte sich neben ihr nieder, fühlte ihren Puls und ihre Schläfe, betrachtete sie sehr aufmerksam und wandte sich dann mit einem solchen Ausdrucke von Entrüstung und Verachtung gegen den Doctor um, daß diesem die Worte auf den Lippen erstarben, und er einen Augenblick bleich vor Zorn und Bestürzung dastand – bleich und völlig sprachlos.
Dann wandte sich Se. Gnaden zu mir.
»Wann fand diese Veränderung statt?« fragte er.
Ich gab ihm die Zeit an.
»Ist Lady Glyde seitdem im Zimmer gewesen?«
Ich sagte ihm, daß sie nicht dagewesen. Der Arzt habe es ihr gestern Abend ausdrücklich untersagt und den Befehl heute Morgen wiederholt.
»Hat man Sie und Mrs. Rubelle mit der ganzen Größe des Unheils bekannt gemacht?« war seine nächste Frage.
Ich entgegnete, wir wüßten, daß die Krankheit eine ansteckende sei. Er unterbrach mich, ehe ich noch ein Wort hinzufügen konnte.
»Es ist Typhus«, sagte er.
In der Minute, welche unter diesen Fragen und Antworten verging, erholte Mr. Dawson sich wieder und wandte sich mit seiner gewohnten Festigkeit zum Grafen.
»Es ist kein Typhus«, sagte er scharf. »Ich protestire gegen diese Einmischung, Sir. Es hat hier Niemand außer mir das Recht, Fragen zu thun. Ich habe nach meinen besten Kräften meine Pflicht gethan –«
Der Graf unterbrach ihn, nicht durch Worte, sondern indem er blos auf das Bett hindeutete. Mr. Dawson schien diesen stillen Widerspruch gegen seine Fähigkeiten zu fühlen und dadurch nur noch gereizter zu werden.
»Ich sage, daß ich meine Pflicht gethan habe,« wiederholte er »Man hat nach einem Arzte in London geschickt. Mit ihm will ich über die Art des Fiebers consultiren und mit sonst Niemandem. Ich bestehe darauf, daß Sie das Zimmer verlassen.«
»Ich betrat dieses Zimmer, Sir, im heiligen Interesse der Menschlichkeit,« sagte der Graf, »und will es in demselben Interesse abermals betreten, falls die Ankunft des Arztes sich verzögert. Ich sage Ihnen nochmals, daß das Fieber sich in Typhus verwandelt hat, und daß Sie durch Ihre Behandlung für diese traurige Veränderung verantwortlich sind. Falls diese unglückliche Dame sterben sollte, will ich es vor einem Gerichtshofe bezeugen, daß Ihre Unwissenheit und Hartnäckigkeit ihren Tod herbeigeführt haben.«
Ehe noch Mr. Dawson ihm antworten und ehe der Graf uns verlassen konnte, öffnete sich die Thür des Wohnzimmers, und Lady Glyde erschien auf der Schwelle.
»Ich muß und will hereinkommen,« sagte sie mit ungewohnter Festigkeit.
Anstatt sie aufzuhalten, trat der Graf ins Wohnzimmer und machte Platz für sie. Bei allen anderen Gelegenheiten war er der letzte Mann in der Welt, der Etwas vergessen hätte; aber in der Ueberraschung des Augenblicks vergaß er offenbar, daß Typhus ansteckend sei, und zugleich die dringende Nothwendigkeit, Lady Glyde zu zwingen, sich in Acht zu nehmen.
Zu meiner Verwunderung bewies Mr. Dawson mehr Geistesgegenwart. Er hielt Mylady beim ersten Schritte, den sie dem Bette zu that, zurück.
»Ich bedaure aufrichtig – es schmerzt mich aufrichtig,« sagte er. »Ich fürchte, das Fieber ist ansteckend. Bis ich mich aber vom Gegentheil überzeugt habe, bitte ich Sie inständigst, nicht ins Zimmer zu kommen.«
Sie kämpfte einen Augenblick, dann sanken plötzlich ihre Arme zu ihren Seiten nieder, und sie fiel vorwärts. Sie war in Ohnmacht gefallen. Die Gräfin und ich nahmen sie dem Doctor ab und trugen sie in ihr Zimmer. Der Graf ging uns voran und wartete dann im Corridor, bis ich wieder herauskam und ihm sagte, daß sie wieder zu sich gekommen sei. Ich kehrte zum Doctor zurück, um ihm auf Lady Glyde’s Befehl zu sagen, daß sie ihn augenblicklich sprechen müsse.« Er ging sofort, um Mylady’s Aufregung zu beruhigen und sie von der Ankunft des Arztes, die in wenigen Stunden erfolgen müsse, in Kenntniß zu setzen. Diese Stunden vergingen sehr langsam. Sir Percival und der Graf waren zusammen unten und ließen sich von Zeit zu Zeit nach dem Befinden der Damen erkundigen. Endlich zwischen fünf und sechs Uhr langte zu unserer, großen Erleichterung der Arzt an.
Er war ein jüngerer Mann als Mr. Dawson, aber sehr ernst und entschlossen. Was er von der vorherigen Behandlung dachte, kann ich nicht sagen; aber es fiel mir auf, daß er mir und Mrs. Rubelle weit mehr Fragen vorlegte, als dem Doctor, und daß er nicht mit vieler Aufmerksamkeit anhörte, was Mr. Dawson sagte, während er die Patientin betrachtete. Nach diesen meinen Bemerkungen begann ich zu argwöhnen, daß der Graf von Anfang an in Bezug auf die Krankheit Recht gehabt hatte, und diese Vermuthung wurde natürlich bestätigt, als Mr. Dawson nach einigem Verzuge die eine wichtige Frage that, welche zu lösender Arzt aus London geholt worden war.
»Was halten Sie von dem Fieber?« fragte er.
»Es ist Typhus,« entgegnete der Arzt, »Typhus ohne den geringsten Zweifel.«
Jene ruhige Ausländerin, Mrs. Rubelle, faltete ihre dünnen braunen Hände und sah mich mit einem bedeutsamen Lächeln an. Der Graf selbst hätte kaum zufriedener aussehen können, falls er im Zimmer gewesen und so die Bestätigung seiner Ansichten vernommen hätte.
Nachdem der Arzt uns einige nützliche Anweisungen in Bezug auf die Pflege der Kranken gegeben und versprochen hatte, daß er nach Verlauf von fünf Tagen wiederkommen werde, zog er sich mit Mr. Dawson zurück, um sich allein mit ihm zu besprechen. Er wollte in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit von Miß Halcombe’s Genesung keine Meinung aussprechen, da es, wie er sagte, in dem gegenwärtigen Stadium der Krankheit unmöglich sei, mit Bestimmtheit zu urtheilen.
Die fünf Tage vergingen uns in großer Besorgniß.
Die Gräfin Fosco und ich lösten Mrs. Rubelle abwechselnd ab, denn Miß Halcombe’s Zustand wurde immer schlimmer und erforderte unsere äußerste Sorgfalt und Aufmerksamkeit. Es war eine sehr, sehr schwere Zeit. Lady Glyde (welche, wie Mr. Dawson sagte, die fortwährende Spannung über den Zustand ihrer Schwester aufrecht erhielt) erholte sich auf wunderbare Weise und bewies eine Festigkeit und Entschlossenheit, die ich ihr nimmer zugetraut hätte. Sie bestand darauf, täglich drei oder vier Mal ins Zimmer zu kommen und Miß Halcombe mit eignen Augen zu sehen, indem sie versprach, nicht zu nahe an das Bett zu treten, falls der Doctor ihr in soweit willfahren wolle. Mr. Dawson gab seine Erlaubniß hierzu mit großem Widerstreben; ich denke mir, er sah wohl ein, daß es nutzlos sein würde, ferner mit ihr darüber zu streiten. Sie kam jeden Tag und hielt ihr Versprechen mit großer Selbstverleugnung. Es war mir persönlich so schmerzlich (denn es erinnerte mich an meinen eigenen Kummer während meines lieben Mannes letzter Krankheit), zu sehen, wie sehr sie unter diesen Umständen litt, daß ich aufrichtig bitte, mir ein ferneres Verweilen bei diesem Gegenstande zu ersparen. Es ist mir eine weit angenehmere Aufgabe, zu berichten, daß keine neuen Uneinigkeiten zwischen Mr. Dawson und dem Grafen stattfanden. Se. Gnaden ließ alle Erkundigungen durch die zweite Hand anstellen und blieb fortwährend unten bei Sir Percival.
Am fünften Tage kam der Arzt wieder und gab uns einige Hoffnung. Er sagte, der zehnte Tag, von dem an gerechnet, an welchem der Typhus zuerst aufgetreten sei, werde wahrscheinlich den Erfolg der Krankheit entscheiden, und versprach uns für diesen Tag seinen dritten Besuch. Die Zwischenzeit verging wie vorher – ausgenommen, daß der Graf eines Morgens abermals nach London reiste und Abends wieder zurückkehrte.
Am zehnten Tage erlöste die barmherzige Vorsehung unser ganzes Haus von aller ferneren Angst und Sorge. Der Arzt gab uns die Versicherung; daß Miß Halcombe völlig außer Gefahr sei.
»Sie bedarf jetzt keines Arztes mehr, – Alles, was sie jetzt noch braucht, ist sorgfältige Aufsicht und Pflege, und Beides wird ihr zu Theil, wie ich sehe.«
Dies waren seine eigenen Worte. An jenem Abend las ich meines lieben Mannes rührende Predigt über Genesung von der Krankheit, und sie that mir (in geistlichem Sinne zu sprechen) wohler und machte mich glücklicher, als dies je vorher der Fall gewesen.
Die Wirkung dieser guten Nachricht auf die arme Lady Glyde war zu meinem Bedauern förmlich überwältigend. Sie war zu schwach, um diese heftige Reaction zu ertragen, und in ein paar Tagen darauf verfiel sie in einen Zustand der Schwäche und Abgespanntheit, welcher ihr nicht gestattete, ihr Zimmer zu verlassen. Ruhe und später vielleicht eine Luftveränderung waren die einzigen Mittel, die Mr. Dawson für sie empfehlen konnte. Es war ein Glück, daß es nicht schlimmer mit ihr war; denn noch an demselben Tage, an welchem sie sich in ihr Zimmer zurückziehen mußte, hatten der Graf und Mr. Dawson wieder einen Wortwechsel, und diesmal war derselbe so ernster Art, daß Mr. Dawson das Haus verließ.
Ich war nicht gegenwärtig, als die Veruneinigung stattfand; aber ich hörte später, daß sie über die Nahrung entstand, welcher Miß Halcombe während ihrer Genesung bedürfe, um sich nach der Erschöpfung des Fiebers wieder zu kräftigen. Mr. Dawson war jetzt, da seine Patientin außer Gefahr, noch weniger als vorher geneigt, sich unberufenen Ansichten zu fügen; und der Graf (ich begreife nicht warum) verlor alle Selbstbeherrschung, die er sich bei früheren Gelegenheiten auf so verständige Weise bewahrt hatte, und verhöhnte den Doctor wiederholt über sein Versehen in Bezug auf das Fieber, als dasselbe sich in Typhus verwandelt hatte. Die unglückselige Geschichte endete damit, daß Mr. Dawson an Sir Percival appellirte und drohte (da Miß Halcombe jetzt außer Gefahr sei) Blackwater Park ganz zu verlassen, falls nicht dem Grafen von diesem Augenblicke an entschieden alle weitere Einmischung untersagt werde. Sir Percival’s Antwort (obgleich keine beabsichtigte Unhöflichkeit) hatte nur dazu gedient, die Sache noch zu verschlimmern; und Mr. Dawson hatte in Folge der unerhörten Behandlung, die ihm vom Grafen Fosco zu Theil geworden, das Haus verlassen und am folgenden Morgen seine Rechnung eingesandt.
Wir waren also jetzt ohne ärztlichen Beistand. Obgleich wir in Wirklichkeit um denselben nicht mehr benöthigt waren – da, wie der Arzt bemerkt hatte, Pflege und Aufmerksamkeit jetzt Alles war, was Miß Halcombe bedurfte – so hätte ich doch, falls meine Autorität für Etwas gegolten hätte, der Form halber aus dem einen oder andern Viertel von London wieder einen Arzt herzugerufen.
Doch schien Sir Percival die Sache nicht in diesem Lichte zu sehen. Er sagte, es werde früh genug sein, einen neuen Arzt zu holen, falls Miß Halcombe einen Rückfall bekäme. Inzwischen sei ja der Graf da, den wir in kleinern Schwierigkeiten um Rath fragen könnten, und es sei unnöthig, unsere Patientin in ihrem gegenwärtigen nervenschwachen Zustande durch Anwesenheit eines Fremden bei ihrem Bette zu stören und aufzuregen. Es war ohne Zweifel viel Verständiges in diesen Erwägungen; aber ich blieb dessenungeachtet ein wenig ängstlich. Außerdem schien es mir nicht ganz billig, Lady Glyde die Abwesenheit des Arztes zu verhehlen, wie wir es thaten. Ich gebe zu, daß es eine wohlgemeinte Täuschung war – denn ihr Zustand war nicht der Art, daß sie neue Besorgnisse hätte ertragen können. Aber es war immer eine Täuschung und als solche für Leute von meinen Grundsätzen, milde ausgedrückt, ein zweifelhaftes Verfahren.
Ein zweiter Umstand, der sich an demselben Tage zutrug und mich unbeschreiblich überraschte – ein Umstand, der mir unbegreiflich war, vergrößerte noch um ein Bedeutendes das Gefühl der Unruhe, das jetzt auf meinem Gemüthe lastete.
Ich wurde zu Sir Percival in die Bibliothek beschieden. Der Graf, welcher bei ihm war, als ich eintrat, erhob sich augenblicklich und ließ uns allein im Zimmer. Sir Percival war so höflich, mich zum Sitzen aufzufordern und redete mich dann zu meinem Erstaunen folgendermaßen an:
»Ich habe über eine Angelegenheit mit Ihnen zu sprechen, Mrs. Michelson, über die ich schon seit einiger Zeit meinen Entschluß gefaßt hatte, und von der ich schon früher mit Ihnen gesprochen haben würde, wenn nicht Kummer und Krankheit ins Haus eingezogen wären. Mit wenig Worten: ich fühle mich bewogen, den hiesigen Haushalt sofort aufzugeben, indem ich das Haus selbst natürlich, wie sonst, Ihrer Aufsicht übergebe. Sobald Lady Glyde und Miß Halcombe im Stande sind zu reisen, müssen beide Damen eine Luftveränderung genießen. Meine Verwandten, der Graf und die Gräfin Fosco, werden uns schon vorher verlassen und eine Wohnung in der Umgegend von London beziehen. Mein Zweck, indem ich keine Gäste mehr in diesem Hause empfange, ist, so sparsam wie möglich zu leben. Ich tadle Sie nicht – aber meine Ausgaben hier sind bei Weitem zu groß. Kurz, ich werde die Pferde verkaufen und sofort die ganze Dienerschaft entlassen. Ich thue nie Etwas zur Hälfte, wie Sie wissen, und es ist meine Absicht, daß das Haus morgen um diese Zeit von einem Rudel unnützer Leute befreit sei.«
Ich hörte ihm wie angewurzelt vor Erstaunen zu.
»Wollen Sie damit sagen, Sir Percival, daß ich die Hausbedienung, die unter meiner Aufsicht steht, entlassen soll, ohne ihr, wie üblich, einen Monat vorher zu kündigen?« fragte ich.
»Allerdings. Wir werden wahrscheinlich Alle, ehe ein Monat verflossen ist, das Haus verlassen haben, und ich beabsichtige durchaus nicht, eine Menge von Bedienten hier in Müßigkeit zu erhalten.«
»Wer soll die Küche besorgen, Sir Percival, so lange Sie noch hier bleiben?«
»Margaret Porcher kann kochen und braten – behalten Sie sie hier. Wozu brauche ich einen Koch, wenn ich keine Mittagsgesellschaften zu geben beabsichtige?«
»Die Person, welche Sie eben genannt haben, Sir Percival, ist die allerunverständigste von allen Stubenmädchen –«
»Behalten Sie sie, sage ich Ihnen, und lassen Sie eine Frau aus dem Dorfe kommen, die das Aufwaschen besorgt und wieder fortgeht. Es muß und soll eine augenblickliche Einschränkung in meinen wöchentlichen Ausgaben stattfinden. Ich habe Sie nicht rufen lassen, damit Sie mir Einwendungen machen, Mrs. Michelson, sondern damit Sie meine Wünsche in Rücksicht auf Sparsamkeit ausführen. Sie werden morgen die ganze faule Bande von Hausdienern – die Porcher ausgenommen – entlassen. Die Porcher hat die Constitution eines Pferdes, und wie ein Pferd soll sie arbeiten.«
»Sie werden mich entschuldigen, Sir Percival, wenn ich Sie daran erinnere, daß die Dienerschaft ihren Lohn für einen Monat haben muß, falls ich ihr nicht einen Monat vorher aufsage?«
»Geben Sie ihn ihr! Ein Monatslohn erspart mir eines Monats Verschwendung und Prasserei in der Bedientenstube.«
Diese letzte Bemerkung enthielt eine höchst beleidigende Verleumdung gegen mein Haushaltungssystem. Ich hatte zu viel Selbstachtung, um mich gegen eine so grobe Beschuldigung zu vertheidigen. Christliche Rücksicht für Lady Glyde’s und Miß Halcombe’s hülflose Lage und auf die ernstlichen Beschwerlichkeiten, die aus meiner Abwesenheit für sie erwachsen konnten, hielten mich allein davon ab, sofort mein Amt niederzulegen. Ich erhob mich sogleich. Es hätte mich in meinen eignen Augen heruntergesetzt, wenn ich hiernach die Unterredung noch einen Augenblick länger hätte dauern lassen.
»Nach dieser letzten Bemerkung, Sir Percival, habe ich Nichts weiter zu sagen. Ihre Befehle sollen erfüllt werden.« Mit diesen Worten machte ich eine kalte Verbeugung und ging aus dem Zimmer.
Am folgenden Tage ging die ganze Dienerschaft ab. Sir Percival selbst lohnte die Reitknechte und Stallleute ab und schickte sie mit allen Pferden, ein einziges ausgenommen, nach London. Die einzigen Personen, welche zurückblieben, waren Margaret Porcher, ich und der Gärtner. Dieser Letztere wohnte jedoch in seinem eignen Hause, und er mußte nach dem einen im Stalle zurückgebliebenen Pferde sehen.
In dieser einsamen Verlassenheit des Hauses, wo die Herrin desselben krank in ihrem Zimmer lag, während Miß Halcombe noch immer so hülflos wie ein Kind war, und der Doctor uns in Feindschaft verlassen hatte, war es gewiß nicht zum Verwundern, daß ich niedergeschlagen wurde und es schwer fand, meine gewohnte Fassung beizubehalten. Ich war ängstlich in meinem Gemüthe, und ich wünschte den beiden armen Damen eine schnelle Genesung und mich selbst fort aus Blackwater Park.
Das nächste Ereigniß, das sich zutrug, war so sonderbarer Art, daß es mir ein Gefühl abergläubischen Erstaunens verursacht haben würde, falls nicht feste religiöse Grundsätze meinen Geist gegen eine derartige heidnische Schwäche gestärkt hätten. Dem unbehaglichen Gefühle, daß Etwas in der Familie nicht ganz richtig sei, in welchem ich mich aus Blackwater Park fortgewünscht hatte, folgte, so seltsam dies auch scheinen mag, wirklich meine Abreise vom Hause. Allerdings war es nur eine kurze Abwesenheit, doch war das Zusammentreffen meiner Meinung nach deshalb nicht weniger bemerkenswerth.
Meine Abreise fand unter folgenden Umständen statt:
An dem Tage, an welchem alle Diener das Haus verlassen, wurde ich abermals zu Sir Percival beschieden. Die unverdiente beleidigende Anspielung, welche er auf meine Haushaltungsweise gemacht, verhinderte mich nicht, wie ich mich zu sagen freue, ihm nach besten Kräften Böses mit Gutem zu vergelten, indem ich seinem Wunsche so bereitwillig und achtungsvoll, wie immer, nachkam. Bei der gefallenen Natur, welche wir Alle theilen, kostete es mich allerdings einige Anstrengung, meine Gefühle zu bekämpfen. Da ich aber an Selbstüberwindung gewöhnt bin, gelang es mir, dies Opfer zu bringen.
Ich fand den Grafen Fosco abermals bei Sir Percival. Doch blieb der Graf diesmal bei der Unterredung anwesend und half Sir Percival seine Pläne entfalten.
Der Gegenstand, auf den sie jetzt meine Aufmerksamkeit lenkten, bezog sich auf die gesunde Luftveränderung, von der wir Alle so große Vortheile für Lady Glyde’s und Miß Halcombe’s Genesung hofften. Sir Percival sagte, daß beide Damen wahrscheinlich (in Folge einer Einladung von Frederick Fairlie Esquire) den Herbst zu Limmeridge in Cumberland zubringen würden. Er sei jedoch der Ansicht, und der Graf (welcher hier das Wort nahm und bis zu Ende der Unterredung behielt) stimmte hierin mit ihm überein, daß es von großem Vortheile für sie sein würde, wenn sie, ehe sie nach dem Norden aufbrächen, erst auf eine Weile das milde Klima von Torquay genössen. Man wünsche daher ernstlich, an diesem Orte eine Wohnung zu miethen, welche alle Bequemlichkeiten und Vortheile bieten würde, derer die Damen so sehr bedürften; doch sei die Schwierigkeit die, eine erfahrene Person zu finden, welche im Stande sei, eine Wohnung zu wählen, wie sie ihrer bedurften. In dieser dringenden Lage wünschte der Graf – in Sir Percival’s Auftrage – zu hören, ob ich Etwas dawider habe, den Damen meinen Beistand zu leisten, indem ich selbst in ihrem Interesse die Reise nach Torquay machte.
Es war für Jemand in meiner Stellung unmöglich, einen in solchen Ausdrücken gemachten Vorschlag entschieden abzuschlagen.
Ich konnte blos wagen, auf die ernstliche Unangemessenheit meiner Abreise von Blackwater Park bei der außergewöhnlichen Abwesenheit aller Diener mit Ausnahme von Margaret Porcher hinzudeuten. Aber Sir Percival sowohl wie der Graf erklärten, daß sie die Unbequemlichkeit im Interesse der kranken Damen sehr gern ertragen wollten. Ich machte dann den achtungsvollen Vorschlag, daß man an einen Hausagenten in Torquay schriebe; aber man erinnerte mich daran, daß es eine Unvorsichtigkeit sein würde, ein Haus zu miethen, das man nicht vorher gesehen habe. Man sagte mir außerdem, daß die Gräfin (welche andernfalls selbst die Reise nach Devonshire gemacht haben würde) ihre Nichte in ihrem gegenwärtigen Zustande nicht verlassen könne, und daß Sir Percival und der Graf Geschäfte mit einander hätten, die sie nöthigten, in Blackwater Park zu bleiben. Kurz, es wurde mir klar gemacht, daß, falls ich die Sache nicht übernähme,·Niemand anders da sei, dem man sie anvertrauen könne. Unter diesen Verhältnissen konnte ich blos Sir Percival ankündigen, daß meine Dienste Miß Halcombe und Lady Glyde zu Gebote stünden.
Es wurde darauf ausgemacht, daß ich am nächsten Morgen abreisen, den darauf folgenden Tag mich mit Untersuchung der passendsten Häuser in Torquay beschäftigen und am dritten mit meinem Berichte zurückkehren sollte. Se. Gnaden schrieb ein Memorandum für mich, das die verschiedenen Erfordernisse angab, welche das von mir zu miethende Haus besitzen mußte, und Sir Percival fügte eine Anmerkung in Bezug auf die pecuniäre Grenze bei.
Meine eigne Ansicht, als ich diese Instruktionen durchlas, ging dahin, daß in keinem Badeorte in ganz England eine Wohnung zu finden sei, wie die, welche hier beschrieben war; und daß man sie, selbst wenn man sie zufälligerweise entdeckte, nimmer für irgend welchen Zeitraum unter den mir vorgeschriebenen Bedingungen erhalten würde. Ich machte beide Herren auf diese Schwierigkeit aufmerksam, aber Sir Percival (welcher es übernahm, mir zu antworten) schien dieselbe nicht einzusehen. Es war nicht meine Sache, den Punkt zu bestreiten, und ich sagte Nichts weiter; aber ich war fest überzeugt, daß das Geschäft, in welchem man mich fortschickte, so mit Schwierigkeiten behaftet war, daß es mir schon ehe ich abreiste, als hoffnungslos erschien.
Vor meiner Abreise überzeugte ich mich indessen, daß Miß Halcombe Fortschritte in der Genesung machte. Doch drückte sich in ihrem Gesichte eine schmerzliche Sorge aus, die mich fürchten ließ, daß sie nicht ganz ruhig im Gemüthe sei. Jedenfalls aber erholte sie sich körperlich schneller, als ich hätte erwarten können, und sie schickte Lady Glyde liebevolle kleine Botschaften, daß sie bereits wieder ganz wohl sei und sie nur bitte, sich nicht zu früh anzustrengen. Ich überließ sie der Sorgfalt von Mrs. Rubelle, die noch immer ebenso unabhängig von allen Uebrigen im Hause war, wie vorher. Als ich an Lady Glyde’s Thür klopfte, sagte man mir, daß sie noch immer in einem sehr traurigen Zustande der Schwäche und Abspannung sei; es war die Gräfin, die mich hiervon unterrichtete, und welche zur Zeit ihrer Nichte in ihrem Zimmer Gesellschaft leistete.
Sir Percival und der Graf gingen zusammen auf dem Wege zur Wohnung des Parkhüters spazieren, als ich abfuhr. Ich machte ihnen meine Verbeugung und verließ das Haus, in dem jetzt kein einziges dienendes Wesen blieb, als die Porcher.
Jeder Mensch muß fühlen, was ich damals selbst empfand: daß diese Umstände mehr als ungewöhnlich – daß sie beinahe verdächtig waren. Aber man erlaube mir zu wiederholen, daß es mir in meiner abhängigen Stellung unmöglich war, anders zu handeln, als ich that.
Der Erfolg meiner Reise nach Torquay war genau der, welchen ich vorausgesehen hatte. Es war in dem ganzen Orte keine Wohnung zu finden, wie ich sie zu miethen beauftragt war, und der Preis, den man mir zu bieten gestattet, war viel zu niedrig, als daß man mir die Wohnung dafür gelassen hätte, selbst wenn sie gefunden worden. Ich kehrte am dritten Tage nach Blackwater Park zurück und benachrichtigte Sir Percival, welcher mir an der Thür begegnete, daß meine Reise eine vergebliche gewesen. Er schien zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, um sich um das Mißlingen meines Auftrages zu bekümmern, und seine ersten Worte unterrichteten mich, daß sogar in der kurzen Zeit meiner Abwesenheit sich eine große Veränderung im Hause zugetragen habe.
Der Graf und die Gräfin Fosco hatten Blackwater Park verlassen und ihre neue Wohnung in St. John’s Wood bezogen.
Ich erfuhr Nichts über die Ursache dieser plötzlichen Abreise – sondern nur, daß der Graf ganz besonders freundliche Grüße für mich zurückgelassen habe. Als ich Sir Percival zu fragen wagte, ob Lady Glyde in Abwesenheit der Gräfin jetzt Jemanden habe, der ihr aufwartete, erwiderte er, sie habe Margaret Porcher, und fügte dann hinzu, daß man eine Frau aus dem Dorfe habe kommen lassen, um die Arbeit in der Küche zu verrichten.
Ich war wirklich entrüstet über diese Antwort – es lag eine so grelle Unschicklichkeit darin, eine untere Stubenmagd in einem Vertrauensposten bei Lady Glyde anzustellen. Ich ging sofort hinauf und traf die Margaret auf dem Schlafstuben-Vorsaal. Man hatte ihrer Dienste nicht bedurft (natürlich nicht); ihre Herrin habe sich am Morgen wohl genug befunden, um ihr Bett zu verlassen. Ich erkundigte mich zunächst nach Miß Halcombe, erhielt jedoch eine so verdrießliche, unverständliche Antwort, daß ich dadurch um Nichts klüger wurde. Ich enthielt mich einer Wiederholung meiner Frage, um mich nicht etwa einer impertinenten Antwort auszusetzen. Es war für eine Person in meiner Stellung in jeder Beziehung passender, mich sofort zu Lady Glyde zu begeben.
Ich fand, daß Mylady sich allerdings während der letzten drei Tage bedeutend erholt hatte. Obgleich noch immer matt und nervenschwach, war sie doch im Stande, sich ohne Hülfe zu erheben und mit langsamen Schritten in ihrem Zimmer umher zugehen, ohne eine schlimmere Wirkung davon zu verspüren, als die einer leichten Ermüdung. Sie hatte den Morgen einige Besorgniß um Miß Halcombe gefühlt, da sie durch Niemanden Nachrichten von ihr erhalten. Mir erschien dies als ein höchst tadelnswerther Mangel an Aufmerksamkeit von Mrs. Rubelle, doch sagte ich Nichts, sondern blieb bei Lady Glyde und half ihr Toilette machen. Als sie damit fertig war, verließen wir zusammen das Zimmer, um zu Miß Halcombe zu gehen.
Im Corridor trafen wir Sir Percival. Er sah aus, als ob er uns dort erwartet habe.
»Wohin gehst Du?« sagte er zu Lady Glyde.
»Nach Mariannen’s Zimmer,« antwortete sie.
»Es mag Dir vielleicht eine Täuschung ersparen,« bemerkte Sir Percival, »wenn ich Dir sage, daß Du sie dort nicht finden wirst.«
»Daß ich sie nicht finden werde?«
»Nein. Sie hat gestern mit Fosco und seiner Frau das Haus verlassen.«
Lady Glyde war nicht stark genug, um den Schlag dieser sonderbaren Nachricht zu ertragen. Sie erbleichte, daß es zum Erschrecken war, und lehnte sich an die Wand, indem sie in tiefem Schweigen ihren Gemahl anblickte.
Ich selbst war so überrascht, daß ich kaum wußte, was ich sagen sollte. Ich frug Sir Percival, ob er wirklich damit sagen wolle, daß Miß Halcombe Blackwater Park verlassen habe.
»Ganz gewiß,« entgegnete er.
»In ihrem Zustande, Sir Percival! und ohne Lady Glyde von ihrer Absicht in Kenntniß zu setzen!«
Ehe er noch eine Antwort geben konnte, erholte Mylady sich wieder etwas und sprach.
»Unmöglich!« rief sie mit lauter, erschrockener Stimme, indem sie sich ein paar Schritte von der Wand entfernte. »Wo war der Arzt? Wo war Mr. Dawson, als Marianne fortging?«
»Wir bedurften Mr. Dawson’s nicht, und er war nicht hier,« sagte Sir Percival. »Er verließ uns aus eignem Antriebe, was hinlänglichen Beweis liefert, daß sie wohl genug war, um die Reise zu machen. Wie Du mich angaffst! Wenn Du mir nicht glauben willst, daß sie fort ist, so sieh selbst nach. Oeffne ihre Zimmerthür und all die andern Thüren, wenn Du willst.«
Sie nahm ihn beim Worte, und ich folgte ihr. Es war Niemand in Miß Halcombe’s Zimmer außer Margaret Porcher, die dort aufräumte. Und es war Niemand in den Fremdenstuben und im Toilettenzimmer, als wir in denselben nachsahen. Sir Percival erwartete uns wieder im Corridor. Als wir das letzte Zimmer, in dem wir nachgesucht hatten, verließen, flüsterte Lady Glyde mir zu: »Gehen Sie nicht fort, Mrs. Michelson! Um Gotteswillen, verlassen Sie mich nicht!«
Ehe ich noch ein Wort der Erwiderung sagen konnte, war sie schon draußen im Corridor und sprach mit ihrem Gemahle.
»Was soll dies bedeuten, Sir Percival! Ich bestehe darauf – ich bitte und flehe Sie an, mir zu sagen, was es bedeuten soll!«
»Es bedeutet,« entgegnete er, »daß Miß Halcombe gestern Morgen wohl genug war, um aufzusitzen und sich ankleiden zu lassen, und daß sie darauf bestand, die Gelegenheit zu benutzen und Fosco nach London zu begleiten.«
»Nach London!«
»Ja, auf der Durchreise nach Limmeridge.«
Lady Glyde wandte sich zu mir.
»Sie sahen Miß Halcombe zuletzt,« sagte sie. »Fanden Sie, daß sie aussah, als ob sie im Stande sein würde, in vierundzwanzig Stunden eine Reise anzutreten?«
»Meiner Ansicht nach nicht, Mylady.« Sir Percival wandte sich jetzt seinerseits ebenfalls zu mir.
»Haben Sie, ehe Sie abreisten,« sagte er, »zu der Wärterin geäußert, Miß Halcombe sehe weit wohler aus, oder haben Sie das nicht gesagt?«
»Die Bemerkung habe ich allerdings gethan, Sir Percival.«
Er wandte sich, sowie ich ihm diese Antwort gegeben, schnell wieder zu Mylady.
»Vergleiche die eine von Mrs. Michelson’s Ansichten ruhig mit der andern,« sagte er, »und versuche, vernünftig und klar über die Sache zu denken. Glaubst Du, daß, falls sie nicht wohl genug gewesen wäre, um die Reise zu ertragen, wir riskirt hätten, sie reisen zu lassen? Sie hat drei zuverlässige Leute um sich, die nach ihr sehen – Fosco, Deine Tante und Mrs. Rubelle, die ausdrücklich zu dem Zwecke mitreiste. Sie nahmen ein ganzes Coupé und machten auf dem einen langen Sitze ein Lager für sie, falls sie sich vom Aufsitzen ermüdet fühlen sollte. Heute setzen Fosco und Mrs. Rubelle mit ihr die Reise nach Cumberland fort.«
»Warum geht Marianne nach Limmeridge und läßt mich hier allein?« sagte Mylady, Sir Percival unterbrechend.
»Weil Dein Onkel Dich nicht aufnehmen will, ohne vorher mit Deiner Schwester gesprochen zu haben,« entgegnete er. »Hast Du den Brief vergessen, den er ihr zu Anfange ihrer Krankheit schrieb? Man zeigte ihn Dir doch – Du lasest ihn und solltest Dich dessen entsinnen.«
»Ich erinnere mich.«
»Warum wunderst Du Dich dann darüber, daß sie Dich verlassen hat? Dich verlangt’s, nach Limmeridge zurückzukehren, und Deine Schwester ist hingereist, um Dir Deines Onkels Erlaubniß hierzu nach seinen eignen Bedingungen zu verschaffen.«
Die Augen der armen Lady Glyde füllten sich mit Thränen.
»Marianne hat mich noch niemals verlassen,« sagte sie, »ohne mir Lebewohl zu sagen.«
»Sie würde Dir auch diesmal Lebewohl gesagt haben,« entgegnete Sir Percival, »hätte sie nicht für Dich und für sich selbst gefürchtet. Sie wußte, daß Du suchen würdest, sie zurückzuhalten, und daß Du sie durch Thränen betrüben würdest. Hast Du sonst noch Einwendungen zu machen? Dann mußt Du hinunter kommen und mir Deine Fragen im Eßzimmer vorlegen. Diese ewigen Quälereien langweilen mich. Ich muß ein Glas Wein haben.«
Er verließ uns plötzlich.
Seine Manier während dieser ganzen seltsamen Unterhaltung war vollkommen verschieden gewesen von dem, was sie gewöhnlich war. Er schien alle Augenblicke fast ebenso aufgeregt und ängstlich, wie seine Gemahlin selbst. Ich hätte mir nimmer gedacht, daß er eine so schwache Gesundheit gehabt, oder so leicht außer Fassung zu bringen gewesen wäre.
Ich versuchte Lady Glyde zu überreden, in ihr Zimmer zurückzukehren; doch war dies nutzlos. Sie blieb im Vorsaale stehen und hatte das Aussehen, als ob sie von einem panischen Schrecken ergriffen sei.
»Es ist meiner Schwester Etwas zugestoßen!« sagte sie.
»Bitte, bedenken Sie, Mylady, welche erstaunliche Energie Miß Halcombe besitzt,« sagte ich. »Sie ist wohl im Stande, eine Anstrengung zu machen, der andere Damen in ihrer Lage nicht gewachsen wären. Ich hoffe und glaube, daß nichts Unrechtes geschehen ist – gewiß ich glaube es.«
»Ich muß Mariannen nachreisen,« sagte Mylady mit demselben erschrockenen Blicke. »Ich muß hin, wo sie ist; ich muß mit meinen eignen Augen sehen, daß sie gesund und am Leben ist. Kommen Sie! Kommen Sie mit mir zu Sir Percival hinunter.«
Ich zögerte, aus Furcht, daß meine Gegenwart als eine Zudringlichkeit angesehen werden möchte; ich wagte Mylady dies vorzustellen, aber sie war taub gegen mich. Sie hielt meinen Arm fest genug, um mich zu zwingen, sie hinunter zu begleiten, und hing sich mit all der wenigen Kraft, die ihr noch blieb, an mich, als ich die Thür des Eßzimmers für sie öffnete.
Sir Percival saß am Tische, und vor ihm auf demselben stand eine Caraffe mit Wein. Als wir eintraten, führte er das Glas an seine Lippen und leerte es in einem Zuge. Da ich bemerkte, daß er mich zornig anblickte, indem er es wieder niedersetzte, versuchte ich, eine Entschuldigung für meine Anwesenheit im Zimmer zu machen.
»Denken Sie etwa, daß hier Geheimnisse vorgehen?« rief er plötzlich aus; »da irren Sie sich – es ist hier nichts Verstecktes, Nichts, das Ihnen oder sonst irgend Jemandem verhehlt würde.« Nachdem er diese seltsamen Worte mit lauter, strenger Stimme ausgesprochen, füllte er sein Glas wieder und fragte Lady Glyde, was sie von ihm wolle.
»Wenn meine Schwester im Stande ist, zu reisen, so bin ich es ebenfalls,« sagte Mylady mit größerer Festigkeit, als sie noch bisher gezeigt hatte. »Ich bitte Dich, mich für meine Besorgniß um Mariannen zu entschuldigen, und mir zu erlauben, ihr sofort mit dem Nachmittagszuge nachzureisen.«
»Du wirst bis morgen warten müssen,« entgegnete Sir Percival, »und dann, wenn ich Dich nicht vom Gegentheil unterrichte, kannst Du reisen. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, daß irgend Etwas dazwischen kommen wird, und will deshalb mit der Abendpost an Fosco schreiben.«
Er sagte diese letzten Worte, indem er sein Glas gegen das Licht hielt und den darin funkelnden Wein anschaute, anstatt seine Frau anzusehen. Er sah sie in der That während der ganzen Unterredung nicht an. Ein so merkwürdiger Mangel an Aufmerksamkeit fiel mir, ich muß es gestehen, bei einem Manne von Percival’s Range und Bildung sehr schmerzlich auf.
»Wozu wolltest Du an Graf Fosco schreiben?« frug sie im größten Erstaunen.
»Um ihm zu sagen, daß er Dich mit dem Mittagszuge erwarten möge,« sagte Sir Percival. »Er wird Dich an der Station empfangen und Dich von da mitnehmen, damit Du die Nacht im Hause Deiner Tante in St. John’s Wood schläfst.«
Lady Glyde’s Hand fing heftig auf meinem Arme zu zittern an – ich begriff nicht warum.
»Es ist nicht nöthig, daß Graf Fosco mich auf der Station abholt,« sagte sie, »ich will die Nacht lieber in London bleiben.«
»Du mußt es aber. Du kannst die ganze Reise nach Cumberland nicht in einem Tage machen. Du mußt die Nacht in London schlafen – und ich will nicht, daß Du allein in ein Hotel gehst. Fosco hat Deinem Onkel das Anerbieten gemacht, Dich in seinem Hause zu empfangen, und Dein Onkel hat es angenommen. Da, da ist ein Brief von ihm an Dich. Ich hätte ihn Dir heute Morgen hinaufschicken sollen, aber ich vergaß es. Lies ihn und sieh, was Mr. Fairlie selbst Dir darüber schreibt.«
Lady Glyde blickte den Brief einen Augenblick an und reichte ihn dann mir hin.
»Lesen Sie ihn,« sagte sie mit matter Stimme, »ich weiß nicht, was mir fehlt – ich kann ihn nicht selbst lesen.«
Das Billet enthielt blos drei Zeilen – es war so kurz und theilnahmlos, daß ich darüber erstaunte. Falls mich mein Gedächtniß nicht täuscht, enthielt es Nichts als folgende Worte:
»Liebste Laura – bitte, komm, sobald es Dir gefällt. Verkürze die Reise, indem Du in London im Hause Deiner Tante schläfst. Bedaure zu hören, daß die gute Marianne krank ist.
Herzlich der Deine, Frederick Fairlie.«
»Ich möchte lieber nicht dorthin gehen – ich möchte die Nacht lieber nicht in London bleiben,« sagte Mylady eifrig, ehe ich noch mit dem Lesen des Billets zu Ende, so kurz dasselbe auch war. »Schreibe nicht an Graf Fosco! Bitte, bitte, schreibe nicht an ihn!«
Sir Percival nahm nochmals die Weincaraffe zur Hand und füllte sein Glas, aber mit solchem Ungeschick, daß er es umstieß und den Wein über den Tisch hingoß. »Mir scheint, ich werde blind,« brummte er mit seltsam flüsternder Stimme vor sich hin. Er stellte das Glas langsam wieder auf, füllte es und leerte es abermals mit einem Zuge. Ich begann, nach seinem Wesen und Aussehen zu fürchten, daß ihm der Wein zu Kopf steige.
»Bitte, schreibe nicht an Graf Fosco!« bat Lady Glyde dringender denn je.
»Ich möchte wissen, warum nicht!« rief Sir Percival mit einem plötzlichen Zornesausbruche aus, der uns Beide erschreckte. »Wo kannst Du wohl mit größerer Schicklichkeit die Nacht in London zubringen, als in dem Hause, welches Dein Onkel selbst dazu bestimmt hat – im Hause Deiner Tante? Frage Mrs. Michelson.«
Das vorgeschlagene Arrangement war so ohne Frage das richtigste und passendste, daß ich durchaus Nichts dagegen einwenden konnte. So sehr ich auch in andern Beziehungen mit Lady Glyde sympathisirte, ihre ungerechten Vorurtheile gegen Graf Fosco konnte ich nicht theilen. Es ist mir noch nie eine Dame von ihrem Range und ihrer Bildung vorgekommen, bei der ich eine so beklagenswerthe Engherzigkeit gegen Ausländer gefunden hätte. Weder das Billet ihres Onkels, noch Sir Percival’s zunehmende Ungeduld schienen den geringsten Eindruck auf sie zu machen. Sie weigerte sich immer wieder, die Nacht in London zu bleiben, und wiederholte ihre Bitten an ihren Gemahl, doch nicht an den Grafen Fosco zu schreiben.
»Hör’ auf!« sagte Sir Percival, indem er uns unhöflich den Rücken zuwandte. »Wenn Du selbst nicht Verstand genug hast, um einzusehen, was gut für Dich ist, so müssen Andere dies für Dich einsehen. Ich habe es nun einmal so bestimmt und damit Punktum Du sollst blos thun, was Miß Halcombe bereits vor Dir gethan –«
»Marianne!« wiederholte Mylady in verwirrtem Erstaunen, »Marianne hätte in Graf Fosco’s Hause die Nacht zugebracht?!«
»Ja, in Graf Fosco’s Hause. Sie schlief dort vergangene Nacht, um nicht die ganze Reise mit einemmale zu machen. Und Du sollst ihrem Beispiele folgen und thun, was Dein Onkel Dir sagt. Du sollst morgen Abend in Fosco’s Hause ausruhen, um die Reise zu verkürzen, wie Deine Schwester gethan hat. Mache mir nicht zu viele Einwendungen, oder Du wirst es noch dahin bringen, daß ich es bereue, Dich überhaupt fortzulassen!«
Er sprang auf und ging schnell durch die offene Glasthür auf die Veranda hinaus.
»Wollen Sie mich entschuldigen, Mylady,« sagte ich, »wenn ich vorzuschlagen wage, daß wir lieber nicht hier bleiben, bis Sir Percival zurückkommt? Ich fürchte sehr, daß er vom Weine erregt ist.«
Sie willigte mit zerstreutem, matten Wesen ein, das Zimmer zu verlassen.
Sobald wir Beide wieder oben angelangt waren, that ich mein Möglichstes, um Mylady zu beruhigen. Ich erinnerte sie daran, daß Mr. Fairlie’s Briefe an Miß Halcombe und an sie jedenfalls das vorgeschriebene Verfahren billigten, ja es sogar nothwendig machten. Sie stimmte hierin mit mir überein und gab sogar zu, daß beide Briefe genau in dem eigenthümlichen Geiste ihres Onkels geschrieben seien – aber ihre Sorge um Miß Halcombe und ihre unbegreifliche Angst vor einer Nacht in Graf Fosco’s Hause in London, blieben ungeachtet all’ meiner dringenden Gegenvorstellungen, dieselben. Ich hielt es für meine Pflicht, gegen Lady Glyde’s ungünstige Meinung von Sr. Gnaden zu protestiren, und ich that es mit aller Achtung und Nachsicht.
»Mylady werden mir verzeihen, daß ich mir die Freiheit nehme,« bemerkte ich zum Schlusse, »aber es steht geschrieben: An ihren Früchten sollt Ihr sie erkennen. Des Grafen unausgesetzte Güte und Aufmerksamkeit gleich vom Anfange von Miß Halcombe’s Krankheit an verdienen wirklich unser ganzes Zutrauen und die größte Achtung. Selbst Sr. Gnaden ernstliche Entzweiung mit Mr. Dawson war ganz und gar seiner Sorge um Miß Halcombe zuzuschreiben.«
»Welche Entzweiung?« frug Mylady mit einem plötzlichen Ausdrucke des Interesses.
Ich theilte ihr die unglücklichen Umstände mit, unter welchen Mr. Dawson sich zurückgezogen hatte – und zwar um so bereitwilliger, weil ich es durchaus nicht billigte, daß Sir Percival fortfuhr, Lady Glyde zu verhehlen (wie er es in meiner Gegenwart gethan), was sich zugetragen hatte.
Mylady stand heftig und allem Anscheine nach durch Das, was ich ihr erzählt, doppelt aufgeregt und beunruhigt auf.
»Dies ist schlimm! schlimmer noch, als ich gedacht hatte!« sagte sie, indem sie in höchster Bestürzung im Zimmer auf und ab ging. »Der Graf wußte, daß Mr. Dawson nimmermehr in Marianne’s Reise willigen würde, und beleidigte ihn absichtlich, um ihn aus dem Hause zu schaffen.«
»O Mylady! Mylady;!« sagte ich in vorstellendem Tone.
»Mrs. Michelson!« fuhr sie heftig fort, »keine Worte, die je gesprochen werden können, werden mich überzeugen, daß meine Schwester sich mit ihrer Zustimmung im Hause und in der Gewalt jenes Mannes befindet. Mein Entsetzen vor ihm ist der Art, daß Nichts, was Sir Percival sagen oder mein Onkel schreiben könnte, mich bewegen sollte – falls ich blos meine eigenen Gefühle zu berücksichtigen hätte – unter seinem Dache zu essen, zu trinken oder zu schlafen. Aber meine Angst der Ungewißheit um Mariannen giebt mir den Muth, ihr zu folgen, wohin es auch sei – ja selbst bis in Graf Fosco’s Haus.«
Ich hielt es hier für Recht zu erwähnen, daß Miß Halcombe nach Sir Percival’s Angabe bereits nach Cumberland abgereist sein müsse.
»Ich wage es nicht zu glauben!« entgegnete Mylady. »Ich fürchte, sie ist noch immer in jenes Mannes Hause. Falls ich mich täusche – falls sie wirklich schon auf dem Wege nach Limmeridge ist – bin ich entschlossen, morgen Nacht nicht unter Graf Fosco’s Dache zu schlafen. Die liebste Freundin, die ich, nächst meiner Schwester, in der Welt besitze, wohnt nahe bei London. Sie haben mich und Miß Halcombe doch von Mrs. Vesey sprechen hören? Ich werde an sie schreiben und ihr sagen, daß ich die Nacht in ihrem Hause zubringen will. Ich weiß nicht, wie ich zu ihr gelangen – weiß nicht, wie ich dem Grafen ausweichen soll, aber zu ihr will ich fliehen, sollte meine Schwester bereits nach Cumberland abgereist sein. Alles, worum ich Sie bitte, ist, daß Sie Sorge tragen, daß mein Brief an Mrs. Vesey ebenso sicher heute Abend nach London abgeht, wie Sir Percival’s Brief an Graf Fosco. Ich habe Grund, mich nicht auf die Posttasche zu verlassen. Wollen Sie mein Geheimniß bewahren und mir hierin helfen? Es wird vielleicht die letzte Gefälligkeit sein, um die ich Sie je ersuchen werde.«
Ich zögerte – es kam mir Alles sehr seltsam vor – ich fürchtete beinah, daß Mylady’s Geist durch die kürzlich ausgestandenen Sorgen und Leiden ein wenig zerrüttet sei. Doch endete ich damit, daß ich auf eigene Gefahr hin einwilligte. Wäre der Brief an eine fremde Person oder an irgend Jemand anders, als die mir dem Rufe nach so wohlbekannte Mrs. Vesey gerichtet gewesen, hätte ich mich wahrscheinlich geweigert. Ich danke Gott – wenn ich bedenke, was sich später ereignete – ich danke Gott, daß ich Lady Glyde weder diesen noch irgend einen andern Wunsch versagte, den sie während dieses letzten Tages ihres Aufenthaltes in Blackwater Park aussprach.
Sie schrieb den Brief und übergab ihn mir. Abends trug ich ihn selbst ins Dorf und that ihn in den Briefkasten.
Wir hatten während des ganzen übrigen Tages Sir Percival nicht wieder zu Gesicht bekommen. Ich schlief auf Lady Glyde’s Wunsch in dem Zimmer neben dem ihrigen, und die Thür zwischen beiden Zimmern blieb offen stehen. Es lag in der Einsamkeit und Leere des Hauses etwas so Sonderbares und Unangenehmes, daß ich meinerseits froh war, eine Gefährtin in der Nähe zu haben. Mylady blieb spät auf, indem sie beschäftigt war, Briefe zu lesen und zu verbrennen, und aus ihren Auszügen und Schränkchen kleine Gegenstände, die ihr werth waren, herauszunehmen, als ob sie nicht erwarte, je nach Blackwater Park zurückzukehren. Ihr Schlaf, als sie sich endlich zu Bette gelegt, war sehr unruhig: sie schrie mehrere Male laut auf, einmal so laut, daß sie selbst darüber erwachte. Welcher Art aber ihre Träume sein mochten, mir theilte sie dieselben nicht mit. Vielleicht hatte ich in meiner Stellung nicht das Recht, Dies von ihr zu erwarten. Es kommt jetzt wenig darauf an. Ich war sehr bekümmert um sie – gewiß, ich war dessenungeachtet von ganzem Herzen bekümmert um sie.
Der folgende Tag war schön und sonnenhell. Sir Percival kam nach dem Frühstücke zu uns herauf und benachrichtigte uns, daß der Wagen um ein Viertel vor zwölf Uhr vor der Thüre sein werde – der Zug, mit dem wir nach London gehen wollten, hielt zwanzig Minuten nach zwölf bei unserer Station an. Er sagte, er sei genöthigt, auszugehen, fügte aber hinzu, daß er vor ihrer Abreise zurückzusein hoffe. Falls er aber durch irgend einen Zufall hieran verhindert würde, so sollte ich sie nach der Station begleiten und Sorge tragen, daß sie nicht zu spät käme. Sir Percival gab uns diese Instructionen, indem er sehr hastig sprach und fortwährend aufgeregt im Zimmer auf und ab ging. Mylady blickte ihm aufmerksam nach, wohin er ging. Er sah sie nicht ein einziges Mal an.
Sie sprach erst, als er geendet, und hielt ihn dann zurück, als er aus der Thür gehen wollte, indem sie ihm die Hand hinreichte.
»Ich werde Dich nicht mehr sehen,« sagte sie sehr deutlich; »hier scheiden wir – vielleicht auf immer. Willst Du versuchen, mir zu vergeben, Percival, so von Herzen, wie ich Dir vergebe?«
Es zog sich eine furchtbare Blässe über sein Gesicht, und große Schweißperlen standen ihm auf der kahlen Stirn. »Ich werde zurückkommen,« sagte er und eilte nach der Thür, als ob die Worte seiner Frau ihn hinausgejagt hätten.
Ich hatte Sir Percival nie sehr gern gehabt, aber die Art und Weise, in der er Lady Glyde verließ, verursachte mir förmlich Scham, daß ich je sein Brod gegessen und in seinem Dienste gelebt hatte. Ich wollte der armen Dame ein paar trostreiche, christliche Worte sagen, aber es lag Etwas in ihrem Gesichte, als sie ihrem Manne nachblickte, bis er die Thür hinter sich geschlossen hatte, das mich umstimmte und zu schweigen bewog.
Zur bestimmten Zeit fuhr der Wagen vor. Mylady hatte Recht: Sir Percival kam nicht zurück. Wir warteten bis zum letzten Augenblicke auf ihn – aber vergebens.
Es ruhte keine positive Verantwortlichkeit auf mir, und doch war ich unruhigen Geistes. »Es ist doch Mylady’s freier Wille,« sagte ich, als wir durch das Thor fuhren, »daß Sie jetzt nach London reisen?«
»Ich würde hingehen, wohin man wollte, um die furchtbare Ungewißheit zu enden, die ich in diesem Augenblicke erdulde!« entgegnete sie.
Sie hatte es dahin gebracht, daß ich fast ebenso unruhig und besorgt um Miß Halcombe geworden, wie sie selbst. Ich wagte, sie um eine Zeile der Nachricht zu bitten, falls in London Alles gut ginge. Sie antwortete:
»Sehr gern, Mrs. Michelson.«
»Wir haben Alle unser Kreuz zu tragen, Mylady,« sagte ich, da ich sah, daß sie schweigsam und gedankenvoll wurde, nachdem sie mir zu schreiben versprochen hatte. Sie antwortete nicht; sie schien zu sehr in ihre eigenen Gedanken versunken, um auf mich zu achten. »Ich fürchte, Mylady schliefen schlecht in der Nacht,« bemerkte ich nach einer kleinen Weile. »Ja,« sagte sie, »ich wurde durch furchtbare Träume gestört.« »Wirklich, Mylady?« Ich dachte, sie sei im Begriffe, mir ihre Träume zu erzählen; aber nein; als sie das nächste Mal wieder sprach, war es, um eine Frage zu thun. »Haben Sie den Brief an Mrs. Vesey mit eigener Hand in die Post gethan?«
»Ja, Mylady?«
»Sagte Sir Percival gestern, daß der Graf Fosco mich an der Station in London empfangen werde?«
»Ja, Mylady.«
Sie seufzte schwer auf, als ich diese letzte Antwort gab und sagte Nichts weiter.
Wir kamen kaum zwei Minuten vor Abgang des Zuges auf der Station an. Der Gärtner, welcher uns gefahren hatte, sah nach dem Gepäcke, während ich Mylady’s Billet besorgte. Es wurde bereits zur Abfahrt gepfiffen, als ich zu Mylady an den Perron zurückkehrte. Sie sah sehr seltsam aus und preßte plötzlich die Hand aufs Herz, wie wenn sie ein heftiger Schmerz oder Schreck durchfahren hätte.
»Ich wollte, Sie kämen mit mir!« sagte sie, mich hastig beim Arme ergreifend, als ich ihr das Billet übergab.
Wäre noch Zeit dazu gewesen und hätte ich den Tag vorher gefühlt, was ich jetzt fühlte, so würde ich meine Vorbereitungen getroffen haben, um sie zu begleiten, selbst wenn ich dadurch genöthigt worden wäre, Sir Percival auf der Stelle meine Dienste aufzukündigen. So aber wurden ihre Wünsche, im letzten Augenblicke ausgesprochen, mir zu spät bekannt, um ihnen zu willfahren. Sie schien dies selbst einzusehen, bevor ich noch Zeit hatte, es ihr zu erklären, und wiederholte ihren Wunsch, mich zur Reisegefährtin zu haben, nicht. Der Zug hielt vor dem Perron. Sie gab dem Gärtner, ehe sie in den Waggon stieg, ein Geschenk für seine Kinder und reichte mir auf ihre einfache, herzliche Weise die Hand.
»Sie sind sehr freundlich gegen mich und meine Schwester gewesen,« sagte sie, »sehr freundlich, da wir Beide freundlos waren. Ich werde mich Ihrer dankbar erinnern, solange ich mich noch an irgend Etwas werde erinnern können. Adieu – und Gott segne Sie!«
Sie sprach diese Worte in einem Tone und mit einem Blicke, daß mir darüber die Thränen in die Augen traten – sie sprach sie, als ob sie mir auf immer Lebewohl sagte.
»Leben Sie wohl, Lady,« sagte ich, ihr in den Wagen helfend und indem ich sie aufzumuntern suchte, »aber nur für jetzt Lebewohl; meine besten Wünsche für glücklichere Zeiten begleiten Sie!«
Sie schüttelte den Kopf und schauderte zusammen, als sie sich in den Wagen setzte. Der Schaffner schloß die Thür. »Glauben Sie an Träume?« flüsterte sie mir durchs Fenster zu. Meine Träume in der vorigen Nacht waren solche, wie ich sie noch nie gehabt habe; und das Entsetzen derselben verfolgt mich noch immer.«
Es wurde gepfiffen, ehe ich noch Etwas erwidern konnte, und der Zug setzte sich in Bewegung Ihr weißes, ruhiges Gesicht sah mich an – schaute mich noch einmal durchs Fenster kummervoll und feierlich an – sie winkte mit der Hand – und ich sah sie nicht mehr.
Gegen fünf Uhr an demselben Nachmittage setzte ich mich in meinem Zimmer, da mir inmitten meiner zahlreichen Haushaltspflichten ein wenig Zeit übrig blieb, um durch eine der Predigten meines lieben Mannes mein Gemüth etwas zu beruhigen. Zum ersten Male in meinem Leben gewahrte ich, daß meine Aufmerksamkeit von den frommen und aufrichtenden Worten abschweifte. Indem ich schloß, daß Lady Glyde’s Abreise mich weit tiefer betrübt, als ich mir zuerst eingestanden, legte ich das Buch von mir und ging hinaus, um einen kleinen Gang durch den Garten zu machen. Sir Percival war, soviel mir bekannt, noch nicht zurückgekehrt, und ich brauchte daher keinen Anstand zu nehmen, mich in den Parkanlagen sehen zu lassen.
Als ich um die Ecke des Hauses bog und den Garten sehen konnte, war ich überrascht, eine fremde Person drin spazierengehen zu sehen. Es war eine Frau, die langsam, den Rücken mir zugewendet, dem Pfade entlang ging und Blumen pflückte.
Als ich näher herankam, hörte sie mich und wandte sich um.
Mein Blut erstarrte mir in meinen Adern. Die fremde Person im Garten war Mrs. Rubelle.
Ich konnte mich weder rühren noch sprechen. Sie trat so gelassen, wie immer, mit den Blumen in der Hand zu mir heran.
»Was giebt es, Madame?« frug sie ganz ruhig.
»Sie hier?« sagte ich mühsam. »Nicht in London! Nicht in Cumberland?«
Mrs. Rubelle athmete mit einem Lächeln maliciösen Mitleids den Duft ihrer Blumen ein.
»Gewiß nicht,« sagte sie. »Ich habe Blackwater Park keinen Augenblick verlassen.«
Ich sammelte Muth und Athem zu einer zweiten Frage.
»Wo ist Miß Halcombe?«
Mrs. Rubelle lachte mir diesmal gerade ins Gesicht und antwortete:
»Miß Halcombe, Madame, hat Blackwater Park ebenfalls nicht verlassen.«
Miß Halcombe hatte Blackwater Park nicht verlassen!
Als ich diese Worte hörte, flogen meine Gedanken augenblicklich zu meinem Scheiben von Lady Glyde zurück. Ich kann kaum sagen, daß ich mir Vorwürfe machte, aber in dem Augenblicke hätte ich gern die sauren Ersparnisse von vielen Jahren darum gegeben, wenn ich vier Stunden früher gewußt hätte, was ich jetzt wußte.
Mrs. Rubelle stand ruhig da und machte sich mit ihren Blumen zu schaffen, als ob sie erwarte, daß ich Etwas sagen werde.
Ich konnte Nichts sagen. Ich dachte an Lady Glyde’s erschöpfte Kräfte und schwache Gesundheit und zitterte bei dem Gedanken an den Augenblick, wo der Schlag dieser Entdeckung auf sie fallen würde. Meine Befürchtungen für die gute Dame ließen mich ein paar Minuten völlig verstummen. Nach Verlauf derselben blickte Mrs. Rubelle seitwärts von ihren Blumen auf und sagte: »Hier kommt Sir Percival von seinem Ritte zurück, Madame.«
Ich sah ihn ebensobald, wie sie ihn gesehen. Er kam auf uns zu, indem er grimmig mit der Reitpeitsche in die Blumen hieb. Als er nahe genug herangekommen war, um mein Gesicht zu sehen, stand er still, schlug mit der Peitsche an seine Stiefeln und brach in ein so rauhes, widriges Lachen aus, daß die Vögel erschrocken aus dem Baume herausflatterten, neben welchem er stand.
»Nun, Mrs. Michelson,« sagte er, »sind Sie endlich dahinter gekommen?«
Ich erwiderte Nichts, und er wandte sich gegen Mrs. Rubelle.
»Wann ließen Sie sich im Garten sehen?«
»Vor ungefähr einer halben Stunde, Sir. Sie sagten, ich könne meine Freiheit haben, sobald Lady Glyde nach London abgereist sei.«
»Ganz recht. Ich tadle Sie nicht. Es war eine blose Frage.« Er schwieg einen Augenblick und wandte sich dann wieder zu mir. Sie können’s nicht glauben, wie?« sagte er spöttisch. »Hier! kommen Sie mit und sehen es selbst.«
Er ging voran bis zur Vorderseite des Hauses. Ich folgte ihm und Mrs. Rubelle mir. Nachdem wir durch die eisernen Thore gegangen, stand er still und wies mit der Peitsche auf das unbewohnte Centrum des Gebäudes.
»Da!« sagte er, »sehen Sie nach den Fenstern der ersten Etage hinauf. Sie wissen die alten Elisabethischen Schlafzimmer? Miß Halcombe befindet sich in diesem Augenblicke sicher und gemüthlich in dem besten derselben. Führen Sie sie hinein, Mrs. Rubelle (Sie haben doch Ihren Schlüssel?); führen Sie Mrs. Michelson hinein, damit ihre eigenen Augen sie überzeugen, daß diesmal keine Täuschung stattfindet.«
Der Ton, in welchem er zu mir sprach, und die wenigen Minuten, die verflossen waren, seit wir den Garten verlassen, halfen mir, mich wieder zu sammeln. Was ich in diesem kritischen Augenblicke möglicherweise gethan, falls ich mein ganzes Leben im Dienste zugebracht hätte, kann ich nicht sagen. So aber, da ich die Gefühle, die Grundsätze und Erziehung einer gebildeten Dame besaß, konnte ich natürlich über das richtige Verfahren keinen Augenblick im Zweifel sein. Meine Pflicht gegen mich selbst sowohl, wie meine Pflicht gegen Lady Glyde verboten mir, im Dienste eines Mannes zu bleiben, der uns Beide auf so schnöde Weise durch eine Reihe von Unwahrheiten hintergangen hatte.
»Ich muß um Erlaubniß bitten, Sir Percival,« sagte ich·, »ein paar Worte allein mit Ihnen sprechen zu dürfen. Ich werde danach bereit sein, mit dieser Frau zu Miß Halcombe zu gehen.«
Mrs. Rubelle, auf welche ich mit einer leichten Kopfbewegung hingedeutet hatte, roch mit einer impertinenten Miene an ihrem Blumenstrauß und ging dann mit ihrer gewohnten Gelassenheit der Hausthür zu.
»Nun,« sagte Sir Percival scharf, »was giebt’s jetzt?«
»Ich wünsche Ihnen anzukündigen, Sir, daß ich das Amt, welches ich augenblicklich in Blackwater Park bekleide, hiermit niederlege.« Dies war genau, wie ich mich ausdrückte. Ich war entschlossen, daß meine ersten Worte zu ihm die sein sollten, welche ihm meine Dienste aufkündigten.
Er betrachtete mich mit einem seiner finstersten Blicke und fuhr wüthend mit den Händen in die Taschen seines Reitrockes.
»Warum?« sagte er; »ich möchte wissen, warum?«
»Es steht mir nicht zu, Sir Percival, eine Meinung über Das abzugeben, was sich in diesem Hause zugetragen hat. Ich wünsche Niemanden zu beleidigen, sondern blos zu bemerken, daß ich es nicht mit meiner Pflicht gegen Lady Glyde und gegen mich selbst vereinbar halte, länger in Ihren Diensten zu bleiben.«
»Ist es mit Ihrer Pflicht gegen mich vereinbar, dazustehen und geradezu Verdacht auf mich zu werfen?« schrie er auf seine allerheftigste Art. »Ich seh’ schon, wo Sie hinaus wollen. Sie haben sich Ihre eigene gemeine, hinterlistige Ansicht über eine unschuldige Täuschung gebildet, die zu ihrem eigenen Besten gegen Lady Glyde begangen worden. Es war durchaus nothwendig für ihre Gesundheit, daß sie sofort eine Luftveränderung genösse – und Sie wissen so gut wie ich, daß sie nimmer gegangen wäre, so lange sie Miß Halcombe noch hier wußte. Sie ist zu ihrem eigenen Besten getäuscht worden, und Jeder mag Das wissen. Gehen Sie, wenn Sie wollen – es sind reichlich Haushälterinnen zu haben, die vollkommen so gut sind, wie Sie. Gehen Sie wann Sie wollen – aber nehmen Sie sich in Acht, wie Sie mich und meine Angelegenheiten verlästern, sobald Sie einmal aus meinem Dienste sind. Sagen Sie die Wahrheit und Nichts, als die Wahrheit, oder es soll Ihnen schlimm ergehen! Sehen Sie Miß Halcombe selbst und überzeugen Sie sich, ob sie nicht in dem einen Theile des Hauses so gute Pflege genossen hat, wie in dem andern. Denken Sie an des Doctors eigene Worte, daß Lady Glyde sobald wie möglich eine Luftveränderung genießen müsse. Denken Sie an alles Dies und dann wagen Sie es, Etwas gegen mich und mein Verfahren zu sagen!«
Er entlud sich dieser Worte mit einer wahren Wuth und alle in einem Athem, wobei er auf und ab ging und mit der Peitsche in der Luft umher hieb.
Doch konnte Nichts, was er sagte oder that, meine Meinung über die Reihe abscheulicher Unwahrheiten schwankend machen, welche er am gestrigen Tage in meiner Gegenwart gesprochen, noch von der grausamen Täuschung, durch welche er Lady Glyde von ihrer Schwester getrennt hatte, da Jene bereits in ihrer Angst um Miß Halcombe halb den Verstand verloren. Ich behielt diese Gedanken natürlich für mich und sagte Nichts weiter, das ihn aufreizen konnte, aber ich war nichtsdestoweniger entschlossen, meine ausgesprochene Absicht auszuführen. Eine sanfte Antwort wendet den Zorn ab, und ich unterdrückte deshalb meine eigenen Gefühle, als ich ihm eine Antwort zu geben genöthigt war.
»So lange ich in Ihren Diensten bin, Sir Percival,« sagte ich, »hoffe ich hinlänglich meine Pflicht zu kennen, um mich nicht um Ihre Beweggründe zu bekümmern, Sobald ich aber Ihren Dienst verlassen haben werde, denke ich meine Stellung gut genug zu kennen, um nicht über Dinge zu sprechen, die mich Nichts angehen –«
»Wann wollen Sie fort?« unterbrach er mich ohne alle Ceremonie. »Bilden Sie sich nicht ein, daß mir daran liegt, Sie zu behalten – daß ich mich darum betrübe, wenn Sie das Haus verlassen. Ich bin in dieser Sache von Anfang bis zu Ende vollkommen offen und gerecht. Wann wollen Sie fort?«
»Ich möchte gehen, sobald es Ihnen nur paßte, Sir Percival.«
»Das hat gar nichts damit zu thun. Ich werde morgen früh das Haus ganz und gar verlassen und kann heute Abend mit Ihnen abschließen. Falls Sie auf irgend Jemanden Rücksichten zu nehmen wünschen, so können Sie es lieber für Miß Halcombe thun. Mrs. Rubelle’s Zeit ist heute abgelaufen, und sie hat Ursache, zu wünschen, schon heute Abend in London zu sein. Falls Sie gleich abgehen, so wird kein lebendes Wesen da sein, um nach Miß Halcombe zu sehen.«
Ich hoffe, es ist unnöthig für mich zu sagen, daß es nicht in meiner Natur lag, Lady Glyde und Miß Halcombe in einer Lage zu verlassen, wie die, in der sie sich jetzt befanden. Nachdem ich mir erst entschieden von Sir Percival die Versicherung hatte geben lassen, daß Mrs. Rubelle sofort abreisen werde, falls ich ihre Stelle übernähme, und ferner seine Erlaubniß erhalten, Mr. Dawson zu seiner Patientin zurückzurufen, gab ich bereitwillig meine Zustimmung, in Blackwater Park zu bleiben, bis Miß Halcombe meiner Dienste nicht länger bedürfen würde. Es wurde ausgemacht, daß ich Sir Percival’s Advocaten eine Woche vorher davon benachrichtigte, sobald ich fortzugehen wünsche, und daß derselbe die nothwendigen Anstalten treffen solle, eine Stellvertreterin für mich einzusetzen. Die Sache war mit wenig Worten abgemacht, worauf Sir Percival mir frei ließ zu Mrs. Rubelle zurückzukehren. Diese sonderbare Ausländerin hatte während der ganzen Zeit ruhig auf der Thürschwelle gesessen und gewartet, bis ich sie würde zu Miß Halcombe begleiten können.
Ich war kaum zur Hälfte bis ans Haus gelangt, als Sir Percival, welcher in entgegengesetzter Richtung davon gegangen war, stille stand und mich wieder zurückrief.«
»Weshalb verlassen Sie meinen Dienst?« fragte er. Diese Frage war nach dem, was so eben zwischen uns vorgegangen, so merkwürdig, daß ich kaum wußte, was ich darauf erwidern sollte.
»Denken Sie an Dies: ich weiß es nicht, weshalb Sie fortgehen,« fuhr er fort. »Sie werden aber vermuthlich einen Grund dafür angeben müssen, wenn Sie eine neue Stelle antreten wollen. Was ist Ihr Grund? Das Auseinandergehen der Familie? Ist es das?«
»Ich habe nichts Entschiedenes dagegen, Sir Percival, dies als den Grund –«
»Schon gut! Das ist Alles, was ich wissen wollte. Wenn man sich also bei Ihnen erkundigt, so ist das der Grund, den Sie selbst dafür angegeben haben. Sie gehen ab in Folge des Auseinandergehens der Familie.«
Er wandte sich wieder um, ehe ich noch ein Wort erwidern konnte, und ging mit schnellen Schritten den Anlagen zu. Sein Wesen war ebenso sonderbar, wie seine Reden. Ich gestehe, daß er mich beunruhigte.
Selbst Mrs. Rubelle’s Geduld war erschöpft, als ich mich an der Hausthür zu ihr gesellte.
»Endlich!« sagte sie, indem sie mit ihren magern ausländischen Achseln zuckte. Sie ging voran in den bewohnten Theil des Hauses, dann die Treppe hinauf und öffnete mit ihrem Schlüssel die Thür am Ende des Corridors, welcher zu den alten Elisabethischen Zimmern führte – eine Thür, die noch nie geöffnet worden, so lange ich in Blackwater Park gewesen. Die Zimmer selbst waren mir wohl bekannt, da ich sie zu verschiedenen Gelegenheiten von der andern Seite des Hauses aus betreten hatte. Mrs. Rubelle stand an der dritten Thür in der alten Gallerie still, überreichte mir den Schlüssel zu derselben, sowie den Schlüssel zur Verbindungsthür und sagte mir, ich würde Miß Halcombe in diesem Zimmer finden. Ehe ich hineinging, erachtete ich es als zweckmäßig, ihr zu verstehen zu geben, daß man ihrer Aufwartung nicht mehr bedürfe. Demzufolge benachrichtigte ich sie mit wenigen kurzen Worten, daß die Pflege der kranken Dame hinfort gänzlich mir anheimfalle.
»Ich freue mich es zu hören, Madame,« sagte Mrs. Rubelle. »Ich sehne mich sehr danach, zu gehen.«
»Werden Sie heute abreisen?« fragte ich, um meiner Sache gewiß zu sein.
»Jetzt, da Sie die Pflege übernommen haben, Madame, werde ich in einer halben Stunde den Ort verlassen. Sir Percival hat die Güte gehabt, den Wagen und den Gärtner zu meiner Disposition zu stellen, sobald ich ihrer bedürfen würde. Ich werde ihrer in einer halben Stunde bedürfen, um nach der Station zu fahren. Ich habe in Erwartung dessen bereits eingepackt. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Madame.«
Sie machte einen flinken Knix und ging die Gallerie entlang, wobei sie eine Melodie vor sich hinsummte, zu der sie munter mit ihrem Blumenstrauße den Tact schlug. Ich sage es mit aufrichtiger Dankbarkeit, daß dies das Letzte war, was ich von Mrs. Rubelle sah.
Als ich ins Zimmer trat, fand ich, daß Miß Halcombe schlief. Ich betrachtete sie mit Besorgniß, während sie in dem finstern, hohen, altmodischen Bette dalag. Jedenfalls hatte sich ihr Zustand, dem Aussehen nach zu urtheilen, nicht verschlimmert, seit ich sie zuletzt gesehen, und ich muß zugeben, daß, soviel ich sehen konnte, man sie nicht vernachlässigt hatte. Das Zimmer war traurig, staubig und finster; aber das Fenster (welches auf den einsamen Hof an der Hinterseite des Hauses hinausging) war geöffnet, um die frische Luft einzulassen, und Alles, was geschehen konnte, um die Stube wohnlich zu machen, war gethan worden. Die ganze Grausamkeit des von Sir Percival ausgeübten Betruges war auf die arme Lady Glyde gefallen. Das Einzige, worin er oder Mrs. Rubelle Miß Halcombe schlecht behandelt, war, soviel ich bemerken konnte, der Umstand, daß sie sie versteckt hatten.
Ich schlich mich wieder hinaus, während die kranke Dame noch in sanftem Schlummer lag, um dem Gärtner meine Weisungen in Bezug auf das Wiederholen des Arztes zu geben. Ich bat ihn, nachdem er Mrs. Rubelle werde nach der Station gebracht haben, bei Mr. Dawson vorzufahren und ihn mit meiner Empfehlung zu bitten, zu mir zu kommen. Ich wußte, daß er meinetwegen kommen und bleiben würde, sobald er erfuhr, daß Graf Fosco das Haus verlassen.
Im Verlaufe der Zeit kehrte der Gärtner zurück und sagte, daß er zu Mr. Dawson’s Wohnung gefahren, nachdem er Mrs. Rubelle auf der Station abgesetzt habe. Der Doctor lasse mir sagen, er befinde sich selbst nicht wohl, wolle aber wo möglich am folgenden Morgen zu mir kommen.
Als er seine Botschaft ausgerichtet, war er im Begriffe zu gehen, aber ich hielt ihn zurück, um ihn zu bitten, nach dem Dunkelwerden wieder zu kommen und die Nacht in einem der leeren Schlafzimmer zu wachen, damit ich ihn rufen könne, falls irgend Etwas vorfallen sollte. Er begriff vollkommen, wie ungern ich die ganze Nacht allein in diesem einsamsten Theile des verlassenen Hauses zubringen würde, und willigte bereitwillig ein, zwischen acht und neun Uhr wiederzukommen. Er kam pünktlich, und ich hatte alle Ursache, mir zu der Vorsicht Glück zu wünschen, die mich ihn hatte bestellen lassen. Noch vor Mitternacht brach Sir Percival’s seltsame Wuth auf die heftigste und beunruhigendste Weise aus, und wäre nicht der Gärtner da gewesen, um ihn zu besänftigen, fürchte ich mich, zu denken, was hätte geschehen können.
Er war während des ganzen Nachmittags und Abends fast mit unstätem, aufgeregtem Wesen im Hause und im Garten umhergewandert, nachdem er, wie mir’s schien, bei seinem einsamen Diner eine übermäßige Menge Wein getrunken. Wie dem indessen sein mag, ich hörte seine Stimme im neuen Flügel des Hauses laut und zornig ausrufen, als ich, gerade ehe ich zu Bett gehen wollte, eine Gang durch die Gallerie machte. Der Gärtner lief augenblicklich zu ihm hinunter, und ich schloß schnell die Verbindungsthür, damit der Lärm nicht bis zu Miß Halcombe dringen und sie wecken möge. Es währte eine gute halbe Stunde, ehe der Gärtner zurückkam. Er meinte, sein Herr sei gänzlich von Sinnen – nicht durch die Aufregung vom Weine, wie ich vermuthet hatte, sondern durch eine Art Furcht oder Geistesangst, die wir uns auf keine Weise erklären konnten. Er hatte Sir Percival in der Flur gefunden, wo er heftig auf und ab ging, indem er mit jedem Anzeichen der leidenschaftlichsten Wuth schwor, er wolle keine Minute länger in einem solchen alten Kerker, wie seinem eigenen Hause bleiben, und zwar die erste Station seiner Reise sofort mitten in der Nacht antreten. Er hatte den Gärtner, als dieser sich ihm genähert, mit Flüchen und Drohungen hinausgetrieben und ihm befohlen, augenblicklich anzuspannen und den Wagen vor die Thüre zu bringen. Eine Viertelstunde später war Sir Percival zu ihm in den Hof gekommen, auf den Wagen gesprungen, und, indem er das Pferd zum Galopp gepeitscht, sei er im Mondenlichte mit kreideweißem Gesichte davongefahren. Der Gärtner hatte dann gehört, wie er dem Parkthorhüter zugeschrien und auf ihn geflucht hatte, weil er nicht schnell genug herausgekommen, um das Thor zu öffnen, und dann, wie die Räder im rasenden Laufe wieder weiter gerollt – worauf Alles still geworden – und weiter wußte er Nichts.
Am folgenden Tage, oder vielleicht ein paar Tage später (ich weiß es nicht mehr genau), hatte der Stallknecht aus dem alten Wirthshause zu Knowlesbury – unserer nächsten Stadt – den Wagen wieder zurückgebracht. Sir Percival hatte dort angehalten und war später mit dem Bahnzuge weiter gereist – wohin, konnte der Mann uns nicht sagen. Ich erhielt nie weder durch ihn selbst, noch sonst irgend Jemanden fernere Nachrichten über Sir Percival Glyde, und ich weiß nicht, ob er in diesem Augenblicke in England ist oder nicht. Er und ich sind einander nicht mehr begegnet, seit jener Nacht, wo er wie ein ausbrechender Uebelthäter aus seinem eigenen Hause entfloh, und es ist mein inbrünstiges Gebet und meine ernstliche Hoffnung, daß wir einander auch nie wieder begegnen mögen.
Mein eigener Antheil an dieser traurigen Familiengeschichte naht sich jetzt seinem Ende.
Man hat mir gesagt, daß die Einzelheiten in Bezug auf Miß Halcombe’s Erwachen und auf Das, was sich zwischen uns zutrug, als sie mich an ihrem Bette sitzen fand, für den Zweck meiner gegenwärtigen Aussage nicht von Wichtigkeit sind. Es wird genügen, wenn ich hier erwähne, daß sie selbst sich der Art und Weise unbewußt war, auf welche man sie von dem bewohnten Theile des Hauses nach dem unbewohnten geschafft hatte. Sie mußte zur Zeit in einem tiefen Schlafe gewesen sein, ob derselbe aber ein natürlicher oder künstlich herbeigeführter, war sie nicht im Stande zu sagen. Während meiner Abwesenheit in Torquay und der aller Diener vom Hause (mit Ausnahme von Margaret Porcher, deren fortwährende Beschäftigung in Essen, Trinken und Schlafen bestand) war die heimliche Wegschaffung Miß Halcombe’s von einem Theile des Hauses zum andern natürlich mit Leichtigkeit bewerkstelligt worden. Mrs. Rubelle hatte (wie ich entdeckte, da ich mich im Zimmer umsah) Mundvorräthe und sonstige Erfordernisse, wie die Mittel, um heißes Wasser oder Brühe zu bekommen, ohne genöthigt zu sein, ein Feuer anzuzünden, während der wenigen Tage ihrer Gefangenschaft mit der kranken Dame oben gehabt. Sie hatte sich geweigert, die Fragen zu beantworten, welche Miß Halcombe ihr natürlicherweise vorlegte, doch hatte sie sie in anderer Beziehung weder mit Unfreundlichkeit noch Vernachlässigung behandelt. Die Schande, sich zu einem so abscheulichen Betruge hergegeben zu haben, ist die einzige, welcher ich Mrs. Rubelle mit Gewissenhaftigkeit anklagen kann.
Man verlangt keine Einzelheiten von mir (und es ist dies eine große Erleichterung für mich) über die Wirkung der Nachricht von Lady Glyde’s Abreise auf Miß Halcombe, oder der weit traurigeren Nachrichten, welche wir nur zu bald darauf in Blackwater Park erhielten. Ich bereitete sie in beiden Fällen so zart und sorgfältig wie möglich darauf vor, indem ich nur in dem letzteren den Rath des Arztes als Leitung hatte, da Mr. Dawson während mehrerer Tage zu unwohl gewesen, um zu kommen, als ich zu ihm geschickt. Es war eine traurige Zeit; eine Zeit, an die zu denken und von der zu schreiben mich noch jetzt betrübt. Die kostbaren Segnungen religiösen Trostes, durch welche ich Miß Halcombe aufzurichten suchte, wollten lange nicht bis in ihr Herz eindringen; aber ich hoffe und glaube, daß sie endlich doch Platz darin gefunden. Ich verließ sie nicht, bis sie völlig wiederhergestellt war. Der Zug, mit dem ich jenes unglückselige Haus verließ, war derselbe, der auch sie fortführte. Wir trennten uns mit sehr traurigen Gefühlen in London. Ich ging zu einer Verwandten in Islington, und Miß Halcombe reiste nach Cumberland zu Mr. Fairlie.
Ich habe nur noch wenige Zeilen hinzuzufügen, ehe ich diese schmerzliche Aussage beende. Ich werde zu denselben durch ein Gefühl der Pflicht bestimmt.
Ich wünsche hiermit meine eigene feste Ueberzeugung auszusprechen, daß in den soeben von mir mitgetheilten Ereignissen durchaus kein Tadel irgend einer Art auf den Grafen Fosco fällt. Man sagt mir, daß ein furchtbarer Verdacht gehegt und über Sr. Gnaden Betragen sehr ernste Betrachtungen angestellt werden. Doch bleibt mein Glaube an des Grafen Unschuld völlig unerschüttert. Falls er sich mit Sir Percival vereinigte, um mich nach Torquay zu schicken, so that er Dies in einem Irrthume befangen, für den er als Ausländer und Fremder nicht getadelt werden kann. Falls er dazu beitrug, daß Mrs. Rubelle nach Blackwater Park kam, so war es sein Unglück und nicht seine Schuld, wenn diese Ausländerin schlecht genug war, sich an einem Betruge zu betheiligen, den der Herr des Hauses erdachte und ausführte. Ich protestire im Interesse der Moralität dagegen, daß leichtfertigerweise und unverdientermaßen das Verhalten des Grafen Fosco in Frage gezogen werde.
Zweitens wünsche ich, mein aufrichtiges Bedauern darüber auszusprechen, daß ich nicht im Stande bin, mich genau des Datums zu erinnern, an welchem Lady Glyde Blackwater Park verließ, um nach London zu reisen. Ich höre, daß die genaue Angabe des Tages, an welchem diese beklagenswerthe Reise unternommen wurde, von der größten Wichtigkeit ist, und habe mein Gedächtniß deshalb auf das Gewissenhafteste angestrengt; aber leider war meine Bemühung eine vergebliche. Ich kann mich nur noch entsinnen, daß es gegen Ende Juli war. Jeder weiß, wie schwer es ist, nach Verlauf einiger Zeit ein Datum bestimmt anzugeben, falls dasselbe nicht zur Zeit notirt worden. Diese Schwierigkeit ist in meinem Falle noch bedeutend durch die beunruhigenden und verwirrenden Ereignisse vergrößert, welche um die Zeit von Lady Glyde’s Abreise stattfanden. Ich wünsche von ganzem Herzen, ich hätte es mir damals notirt, oder daß meine Erinnerung an das Datum noch so lebhaft wäre wie meine Erinnerung an das Gesicht der armen Dame, als es mich zum letzten Male kummervoll durch’s Wagenfenster anblickte.
Vorheriges
Kapitel
Nächstes
Kapitel
Inhaltsverzeichnis
für diese Geschichte
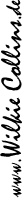
 Startseite
Startseite
 Neuigkeiten
Neuigkeiten Inhaltsverzeichnis aktuelle
Übersetzung
Inhaltsverzeichnis aktuelle
Übersetzung